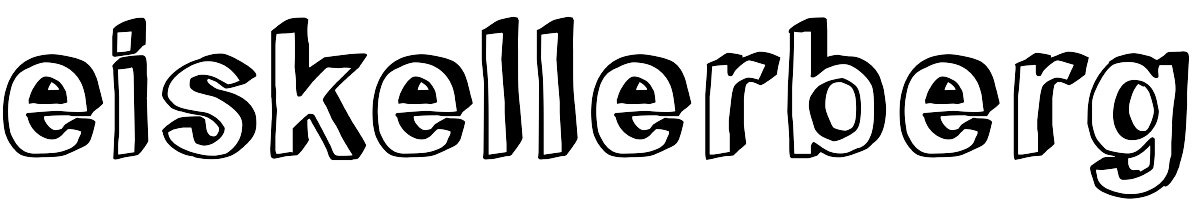Der Zusammenhang zwischen Genie und Wahnsinn gehört zu den beliebtesten Stereotypen der Kunstliteratur. Ein früher Vorläufer dieses Denkmusters, das im 19. Jahrhundert mächtig Auftrieb erhielt, ist der flämische Meister Hugo van der Goes (um 1440–1482). Jetzt versuchen Ausstellungen in Brügge und Berlin, Licht in das Dunkel seiner Biographie zu bringen.
von Jörg Restorff
Der schiere Wahnsinn gleich am Eingang des gotischen Sint-Janshospitaal des Musea Brugge: Der Künstler, der uns hier vorgestellt wird, durchbohrt uns mit seinem irren Blick. Geistige Umnachtung, visuell auf den Punkt gebracht.

Doch hat das hier gezeigte, eindrucksvolle Psychodrama des belgischen Historienmalers Émile Wauters einen Nachteil, jedenfalls dann, wenn man es als historische Quelle zu Rate ziehen will: Es entstand 1872 – knapp 400 Jahre nach dem Tod von Van der Goes, der 1482 im Roode Clooster (Rotes Kloster) bei Brüssel starb. Keine Rede also von Augenzeugenschaft. Doch woher wusste Wauters vom Wahnsinn des Künstlers, dessen ebenso realistische wie subtile Altarbilder in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts höchstes Ansehen genossen, nicht nur in den Burgundischen Niederlanden, sondern bis hin nach Florenz, wie sein berühmter Portinari-Altar in den Uffizien bezeugt?
Émile Wauters bezog sich auf eine Klosterchronik, um 1510 verfasst von einem Mitbruder des Malermönchs, Gaspar Ofhuys. Dem Dunkel des Archivs entrissen hatte die Ofhuys-Chronik übrigens ein Verwandter des Malers, der belgische Historiker Alphonse Wauters. Zu seiner 1872 erschienenen Publikation „Hugues Van der Goes, sa vie et ses œuvres“ lieferte der Neffe Émile die passende Illustration.
Auf dem Gipfel seiner Karriere zog er sich ins Kloster zurück
Was also berichtet Gaspar Ofhuys über das beklagenswerte Schicksal des Hugo van der Goes? Der Künstler, der wohl um 1440 in Gent geboren wurde (weder Geburtsjahr noch Geburtsort sind überliefert) und der dortigen Malergilde 1474/75 als Dekan vorstand, habe auf dem Gipfelpunkt seiner Karriere den Rückzug ins Kloster gewählt, heißt es in der Beschreibung von Ofhuys. Künstlermelancholie, wie sie Dürer 1514, rund 30 Jahre später, in seinem gleichnamigen Meisterstich als Wesenszug der schöpferischen Persönlichkeit postuliert hatte, trieb Hugo ins Roode Clooster in Oudergem bei Brüssel. Glücklicherweise führte die „schwarze Galle“ nicht zum Versiegen der künstlerischen Produktivität. Laut Gaspar Ofhuys setzte der Künstler seine Arbeit im Kloster fort, empfing sogar hochstehende Besucher wie den Erzherzog Maximilian von Österreich, seit 1477 Herzog von Burgund – man darf vermuten, dass der Regent sich vom Fortgang einer durch ihn beauftragten Altartafel ein Bild machen wollte.

Doch um 1480, bei einer Reise der Klosterbrüder nach Köln, eskalierte die “sonderbare Krankheit der Phantasie”, wie Ofhuys berichtet. Auf der Rückfahrt habe der von schweren Depressionen heimgesuchte Maler gar mehrfach versucht, Selbstmord zu begehen. Was tun? Der Abt des Klosters, Thomas Vessem, erinnerte sich an die biblische Erzählung von König Saul, den „ein böser Geist“ ergriffen hatte; psychische Erleichterung verschaffte ihm David durch sein Harfenspiel. So verordnete Vessem geistliche Musik als Antidepressivum – eben das ist auf der linken Hälfte des Gemäldes von Émile Wauters dargestellt. Bei Hugo van der Goes jedoch schlug die Musiktherapie nicht an. Der von Schwermut geplagte Künstler starb 1482 – keine 45 Jahre alt. Soweit die Aussagen von Gaspar Ofhuys, für die es freilich aus anderen Quellen keine Bestätigung gibt. Nicht zu überhören außerdem der moralisierende Unterton seiner Darstellung: In Hugo, dem erfolgreichen Künstler, der im Kloster Privilegien genoss, sah der Chronist einen dekadenten Abweichler, der gegen das von den Mönchen gepredigte asketische Ideal der „Devotio moderna“ verstieß.
Van der Goes und Van Gogh
„In der Geschichte von Genie und Irrsinn, Kunst und Wahn nimmt der Fall des Hugo van der Goes einen hervorragenden Platz ein“, schreibt Gregor Wedekind in seinem aufschlussreichen Aufsatz „Hugos Wahn“, Teil des Katalogs der Berliner Ausstellung „Hugo van der Goes. Zwischen Schmerz und Seligkeit“, die Ende März in der Gemäldegalerie am Kulturforum startet. Vincent van Gogh, zweifellos der berühmteste Geisteskranke der Kunstgeschichte, bezog sich in mehreren Briefen auf das tragische Schicksal seines Vorgängers, wie es ihm in Form des Wauters-Historienbildes vor Augen stand. Wedekind erinnert daran, dass die „romantische Vorstellung des Künstlers als einer unverstandenen, tragisch-scheiternden Figur“ zu den Lieblingsideen des 19. Jahrhunderts zählt. Als Beispiele nennt er unter anderem Eugène Delacroix (Darstellungen des melancholischen Tasso im Gefängnis oder des schwermütigen Michelangelo im Atelier) und Théodore Géricault (Studienköpfe der Monomanen). Ohnehin glaubten schon die alten Römer, dass ein an Leib und Seele gesunder Mensch zu außergewöhnlicher Kunst schlechterdings nicht in der Lage sei: „Nullum magnum sine mixtura dementiae fuit“, lautet ein antikes Credo; „es gibt kein großes Genie ohne einen Hauch von Wahnsinn“.

Foto: Gemäldegalerie Berlin/Dietmar Gunne
1953 meinte der Kunsthistoriker Erwin Panofsky, Hugo van der Goes sei „vielleicht der erste Künstler, der einem Konzept gerecht wurde, das im Mittelalter unbekannt war, aber vom europäischen Geist seither hochgehalten wurde, dem Konzept eines Genies, das sowohl gesegnet als auch verflucht ist mit seiner Verschiedenheit von gewöhnlichen Menschen.“ Aus dieser Perspektive genialer und fataler Andersartigkeit ist Hugo van der Goes der Ahnherr jenes Typus, der bis heute vielen als Synonym des ‚wahren Künstlers‘ gilt.
Vom Meister der sogenannten Flämischen Primitiven reichte dann eine Linie bis zu jenem Strang der Moderne, dessen Ideal der Besessene ist, der Narr, der Unberechenbare und Unbotmäßige, der Psychopath, der malende Berserker. Gewährsleute hierfür gibt es zuhauf – man denke nur an Edvard Munch, dessen „Schrei“ die Daseinsangst stumm artikuliert. Oder an Salvador Dalí, der sich mit Bedacht als durchgeknallter Exzentriker inszenierte („Ohne Wahnsinn gibt es keine Kunst“, soll der Surrealist gesagt haben). Man denke an den Psychiater Hans Prinzhorn, der als einer der ersten die Bildwerke psychisch Kranker als vollgültige Schöpfungen auffasste, an den Maler Jean Dubuffet, der Außenseiter und Sonderlinge der Kategorie „Art brut“ zuordnete und sie dadurch aufwertete, oder an Harald Szeemanns documenta 5 (1972), die der „Bildnerei der Geisteskranken“ den roten Teppich ausrollte. Ein aktuelles Beispiel ist die enorm angesagte japanische Künstlerin Yayoi Kusama, deren „Polka Dots“ von Halluzinationen befeuert wurden.
Malerei ohne Wahnsinn
Die Liste könnte man fortsetzen, doch eine wichtige, vielleicht entscheidende Frage lässt sich auf diese Weise nicht beantworten: Falls Gaspar Ofhuys keine Märchen erzählt hat, falls Hugo van der Goes wirklich dem Wahnsinn anheimgefallen ist – legt seine Malerei davon Zeugnis ab? Konsultiert man die Brügger Ausstellung „Den Tod vor Augen“, die allerdings nur zwei gesicherte Werke des Meisters zeigt, durchmustert man zusätzlich den Katalog der Präsentation in der Gemäldegalerie Berlin, so kann es nur eine Antwort geben: In den Altarbildern, die allesamt nicht ausschließlich auf eigenem Kunstwollen basieren, sondern im Auftrag entstanden sind, findet sich keine Spur von Depression, Exzentrik, Spleen oder gar Kontrollverlust.

Ganz im Gegenteil: Beim Brügger „Marientod“, der hier pars pro toto erwähnt sei, herrscht nicht etwa markerschütternde Verzweiflung; niemand rauft sich vor wahnsinnigem Schmerz die Haare. Vielmehr versammeln sich die Apostel gesittet um das Sterbebett der Muttergottes, um in stiller Trauer Abschied zu nehmen. Das Dekorum bleibt durch die Bank gewahrt.
Sollte dieses Bild tatsächlich von einem geisteskranken Maler geschaffen worden sein, so war er offenbar in der Lage, seine psychische Disposition bei der Arbeit auszublenden. Anders als im Gemälde von Émile Wauters, wo der Wahnsinn des Genies die Hauptrolle spielt, bieten die Bilder von Hugo van der Goes dem Delirium keine Bühne.
Am Rande bemerkt: Aufschlussreich der farbliche Nuancenreichtum, der sich besonders in den Gewändern von Maria, Jesus, den Engeln und den Aposteln zeigt und nach der jüngsten Restaurierung des Gemäldes erst recht zur Geltung kommt. Ein stärkerer Kontrast zu herkömmlicher schwarzer Trauerkleidung ist kaum vorstellbar. Hugo van der Goes war eben kein Van Gogh, kein Munch. Für ihn mag, um Schiller zu variieren, allenfalls diese Devise zutreffen: Düster ist das Leben, heiter ist die Kunst.
„Den Tod vor Augen. Hugo van der Goes: Alter Meister, neue Blicke“,
Musea Brugge/Sint-Janshospitaal, Brügge
bis 5. Februar 2023
„Hugo van der Goes. Zwischen Schmerz und Seligkeit“,
31. März bis 16. Juli 2023