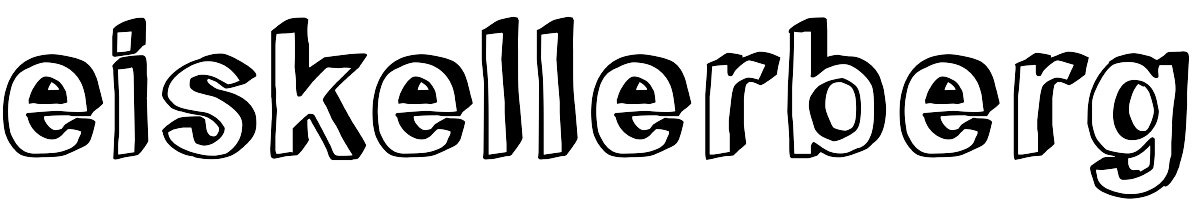Carl Friedrich Schröer
Eine akademische Frage vorweg: Wer will heute schon noch sagen, was Kunst ist – und was nicht? Die Antwort auf die Frage fällt indes leicht: Niemand.
Weil es obsolet geworden ist „über Kunst“ zu streiten? Weil man damit in Teufels Küche kommt? Oder weil man es schlicht nicht mehr kann?
Das ist Folge der selbsternannten „Avantgarde“. Seit ihrem Siegeszug im 20. Jahrhundert ist die Frage nämlich beantwortet: „Kunst ist, was Künstler machen.“ Ende der Diskussion.
Aber wer das Ende der Diskussion postuliert, legt seine autoritären Wurzeln frei.
Die Frage sei erlaubt: Gibt es außerhalb dieser Selbstermächtigung und Absolutsetzung seitens der Künstler eine Einrichtung oder Ebene, die über ihr Schaffen befinden darf? Was ist damit erreicht, es schlicht nicht zu wollen? Und: Wer ist schon alles Künstler?
Damit wären wir bei der Akademie, oder zeitgenössischer gesagt, beim System, das Bewertungen, gar Urteile „über Kunst“ herausmendelt und öffentlich zur Diskussion stellt.
Oder ist es schlicht egal, was wir für Kunst halten, was wir an ihr schätzen und bewundern? Warum wir sie fördern? Was geschieht, wenn wir die Frage unbeantwortet lassen? Ist das gerade die Stärke der offenen Gesellschaft, wenn sie die Trennung von Kunst zu allem Übrigen unbestimmt lässt, sich jeder möglichen Grenze und jedes Urteils entzieht. Oder ist es eine grenzenlose Schwäche ins Beliebige und Allerlei?
Aber wer sollte die Frage beantworten?
Die akademische Frage weitet sich: Was wird aus einer Gesellschaft, die nicht mehr in der Lage ist, eine Übereinkunft darüber zu erzielen, was Kunst ist? Was bedeutet es für die Gesellschaft, ein gesichertes Bewusstsein davon zu haben, was Kunst ist? Was wäre das für eine Gesellschaft, die sich nicht (mehr) sicher sein kann, wovon die Rede ist, wenn wir von Kunst sprechen? –
Kurze Antwort: Eine Gesellschaft, die ihren ästhetischen Kern aufgibt, verliert ihren gesellschaftlichen Kompass. Sie gibt es auf, eine Übereinstimmung darüber zu erzielen, was sie als schön oder hässlich, als misslungen oder geglückt findet.
Eine Gesellschaft, die es sich leistet, nicht mehr bestimmen zu wollen, was Kunst ist, und was nicht, ist sie endgültig offen und befreit? Oder hoffnungslos verloren?
Es kommt also auf die Fähigkeit zur Übereinkunft an. Die einzelnen, unterschiedlichen, persönlichen, höchst individuellen Meinungen wären nur die Ausgangslage für eine breite Diskussion mit dem Ziel der Übereinstimmung (Konsens). Verliert man das Ziel aus den Augen, bleiben partikulare Gesichtspunkte, Geschmäcker und Interessen übrig.
Vielleicht ist es kein Wunder, dass Künstler die Diskussion der Vielen (Kunsthistoriker, Kuratoren, Kritiker und vieler weiterer Teilnehmer am Kunstgeschehen, selbstverständlich auch des Kunsthandels) verschmähen und als „Akademismus“ diskreditieren.
Was wir heute Kunstsystem, oder Kunstszene nennen wird heute weitgehend von zwei Seiten, zwei Mächten eingehegt und bedrängt: von der Moral und vom Markt. Das ist erstaunlich, weil beide „Mächte“ von grundverschieden Interessen ausgehen. Moral kommt ins Spiel, wenn Kunst „gesellschaftsrelevant“ oder gar „gesellschaftverändernd“ argumentieren will. Politische Kunst ist immer moraldurchsetzt und macht sich von Moral abhänging. Ihre Güte steht in Abhängigkeit zu dieser Moral und ob sie wirksam hilft, dise durchzusetzen. Damit ist sie nicht frei, sondern eine abhängige Größe von eben dieser außerkünstlerischen Frage oder Forderung. Ob ein Werk als gut angesehen wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob sein moralischer Anspruch für gut empfunden wird.
Gleichzeitig wird der Wert von Kunst vom Kunstmarkt bestimmt. Das ist spätetens seit Andy Warhols Tagen so. Warhol, ein Bewunderer des großen Duchamp, handelte nach der Devise „nur ein verkauftes Bild, ist ein gutes Bild“ und warf sich dem Kunstmarkt folgerichtig in die Arme. Erst wo künstlerische Kritierien außer Kraft gsetzt sind, gewinnt der Kunstarkt die Oberhand, wo es um die Bewertung von Kunst geht.
Kunst hatte einen Wert, jenseits des kommerziellen Wertes, es besass Güte, Rang und Qualität, Heute bestimmt der Markt den Wert und damit die Qulaität von Kunst. Und liegt damit oft daneben. Wenn ein „Rabbit“ unlängst für 91,1 Millionen Dollar versteigert wurde, ist das zwar unbestritten ein neuer Weltrekord für eine Plastik, aber kein Höhepunkt der modernen Kunst. Sie ist einem Bieter so viele Dollar wert. Er wollte den Hasen des amerikanischen Künstlers Jeff Koons aus welchen Gründen auch immer besizen und hob im New York Auktionshaus seine Hand. Ob der schrille Hase soviele Dollar wert war, wird sich erst erweisen, wenn er demnächst wieder zum Verkau steht. Aber auch dann wird nicht geklärt werden, ob er auch so viel wert ist – wertvoll im Sinne der Kunstgeschichte.
Dazu eine Bemerkung von Gerhard Richter, auf dem Kunstmarkt als der teuertste lebende Maler bewertet:
„Was unsere Zeit ausmacht, ist genau dieser Salonmüll, unwichtig, aufgebläht und albern, den wir in ungeheuerlichen Massen produzieren, den wir diskutieren, kommentieren, in Ausstellungen, Texten, Filmen, Aufführungen dokumentieren, der schlicht das geistige Leben unserer Zeit ist. Kunst ist irgendwo anders.“
Der Bereich des Schönen (Ästhetik) ist ein besonders sensibler, durch viele individuelle Meinungen und Einstellungen geprägter Bereich. Wenn sich eine Gesellschaft als unfähig erweist, hier keine Übereinstellung mehr zu finden, hat sie ein Problem. Sie wird auch gesellschaftlich auseinanderfallen.
Aber die Kunst ist frei! werden sie einwenden. Die Freiheit der Kunst ist doch grundgesetzlich geschützt und von unserem Staat garantiert.
Die Kunstfreiheit ist ein Grundrecht gemäß Artikel 5 Absatz 3 des deutschen Grundgesetzes, das die Freiheit des künstlerischen Schaffens, der Verbreitung und der öffentlichen Zurschaustellung von Kunstwerken schützt.
Kunst ist zusammen mit der Wissenschaft im Grundgesetz herausgehoben und privilegiert geschützt. Damit ist jeder Künstler prinzipiell frei in dem, was er tut, als Kunst behauptet, ausstellt und verkauft. Aber ist deshalb auch alles Kunst, was Künstler machen? Darüber schweigt das Grundgesetz. Die Kunstfreiheit des Grundgesetzes schützt die Künstler vor Bevormundungen und Eingriffen des Staates. Die Freiheit der Kunst meint nicht, dass alles Kunst ist, was sich dafür ausgibt. Vor allem zieht der Staat keine Grenze wo Kultur aufhört, und Kunst anfängt. Weniger nicht und mehr auch nicht. Auch kann sich Künstler oder Künstlerin nennen, wer will. Die Ausübung von jeglichem kreativem Tun ist ungeschützt und steht selbstverständlich jedem und jeder frei. Wo eine Grenze von Kunst zu kreativem Tun und weiter zu Kultur zu ziehen ist, bleibt Aufgabe der Gesellschaft. Entzieht sich diese aber der Aufgabe, wird sie zerfallen.
Warum? Weil Grenzen ziehen, unterscheiden, werten konstitutive Elemente einer Gesellschaft sind. In einer Gesellschaft, in der beide Bereiche, Kunst und Kultur, sich ineinander auflösen, ununterscheidbar werden, werden auch andere substantielle Belange, Begriffe und ihr Bedeutungshintergrund nicht mehr unterscheidbar. Eine Orientierung entfällt.

Wo der Schlachtruf AKADEMISMUS ertönt, denken wir sofort an alte Zöpfe, ergraute Professoren, veralterte Regeln und Rituale. Gar an königliche Akademien des Absolutismus à la Louis XIV. An längst geschlagene (und gewonnene) Schlachten um den Bon Goût und „von oben“ dekretierte Regeln und Geschmacksnormen. Diese Institutionenkritik tauchte allerdings schon mit der Gründung dieser Académie Royale 1648 in Paris auf.
Institutionenkritik ist also selbst ein alter Hut. Sie klingt fortschrittlich und gibt sich immer jung, herausfordernd und anti-autoritär. Aber was wäre sie ohne Institution? Was wäre aller Akademismus ohne Akademie?
Die Akademie als Clearingstation – nicht als autoritäre und elitäre Vorgabe von oben. Vielmehr als Forum der Meinungen, Geschmäcker und Einstellungen mit dem Ziel, eine Verbesserung, eine Qualifizierung der Kunst zu gewinnen, dazu könnte man (staatliche) Kunstakademien brauchen.
Aber nicht einmal darüber besteht Konsens. Die Kunst bessern, gar verbessern? Spitzenleistung auswählen, bewerten, um sie zu fördern? Das alles verstößt doch gegen das Oberdogma der spät-libertären Gesellschaft: „Gerecht ist, was gleich ist.“ Insofern Ungleichheit, also Unterschiedlichkeit prinzipiell moralisch verwerflich ist.
Wo wir nicht mehr gewillt sind zwischen high und low culture, zwischen Subkultur und Hochkultur, auch nicht zwischen ambitioniertem Schund und Meisterwerk zu unterscheiden, was sollen da noch Fragen (gar Methoden), die auf qualitative Unterschiede abzielen und diese aufzeigen. Wäre das – bei allem offensichtlichen Bemühen der doch sehr engagierten Künstlerin – nicht sehr ungerecht?
Weder der Austausch der Meinungen und „Positionen“, noch das Ziel an sich, sind hier entscheidend. Um es politisch zu sagen, weder der libertäre, noch der autoritäre Weg führen weiter.
Es hat sich allerdings in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass der bequeme Weg, es beim bunten Nebeneinander der Vielheiten (Stichwort „Diversity“) oder bestenfalls beim Austausch der unterschiedlichen Meinungen zu belassen („Jeder hat seinen Geschmack“), zu keiner Übereinstimmung führen wird.
Konsens – Konvention
Niemand wird bestreiten, dass es Kunst, auch zeitgenössische Kunst, ohne Tradition, auch ohne Geschichte nicht gibt. Kunstgeschichte (auch Kunstwissenschaft) kann man an vielen Universitäten überall in der Welt lernen. Nun wird sich Kunst nicht allein aus ihrer Tradition heraus entwickeln oder ereignen. Aber ohne Tradition eben auch nicht. Was Kunst ist und was nicht, lässt sich eben (immer noch) am besten aus Vergleichen lernen. Wer Kunst entwickeln will, ebenso.
Akademie – Akademismus – Antiakademismus
Wer für die Akademie eintritt, macht sich verdächtig für Regeln und Normen, gar für Gesetze und Grenzen, für Autoritäten und Experten, für Eliten und Obrigkeiten einzutreten.
Das moderne Akademiewesen wurde schließlich von keinem Geringeren als Ludwig XIV. dem französischen König des Absolutismus, begründet. Wer also gegen die Akademie antritt ist gegen den Absolutismus. Hurra! Er ist auf der Seite der Sieger. Denn schließlich wurde der Absolutismus durch die Französische Revolution erfolgreich bekämpft. Der König und die Königin öffentlich in Paris, der Hauptstadt der modernen Akademien enthauptet.
Wer also gegen die Akademien auftritt, ficht für den demokratisch-pluralistischen Weg. Der Anti-Akademismus als demokratische Losung!
Aber ganz so einfach ist das nicht. In Zeiten, wo ein Donald Trump gegen die Freiheit der Universitäten und Akademien, gegen die Freiheit der Wissenschaften und der Künste antritt, wird es höchste Zeit, sich an das Verbindende zu erinnern. An das verbindende Selbstverständnis einer Gesellschaft über das Schöne.
Wie weit sind wir bei alledem von Platon entfernt, vom dem sich immerhin der Name Akademie ableitet und in die europäische Kultur verpflanzt hat.
In mehreren seiner Dialoge behandelte Platon, der die vielleicht bedeutendste Akademie der antiken Welt begründete, Aspekte der Schönheit. Der Aufstieg zum Schönen findet im Symposion (Trinkgelage) einen prägenden Ausdruck. Teilnehmer am Gelage halten der Reihe nach freie Reden zur Würdigung von Eros. Der später hinzugekommene Sokrates bezieht sich auf Lehren der Seherin und Priesterin Diotima, die Eros mit dem Begehren des Schönen verbunden habe und darüber hinaus darauf hinweist, dass Schönheit nicht nur eine körperlich-sinnliche Seite habe, sondern auch auf eine innere, geistige Qualität ziele, eine schöne Seele. Diese innere Qualität befähige zu guter Letzt, eine dritte Dimension des Eros zu erschließen, nämlich Wesen und Idee der Schönheit, das „Urschöne“ selbst.
Das Schöne erscheint hier als das Göttliche selbst und ist gleichzeitig „der Weg des Göttlichen in die Endlichkeit über alle Stufen.“ Es vollzieht sich im Aufscheinen. „Das Schöne ist schön, während es anderes schön macht und verklärt.“
Von dieser überzeitlichen, überweltlichen und entpersönlichten Sichtweise auf das, was wir gewöhnlich Kunst nennen, sind wir weit entfernt.
Akueller Hinweis
Was ist eigentlich Akademismus? – Die Systemfrage
Carl Friedrich Schröer im Gespräch mit Robert Olawuyi, „The Gen Z Art Critic“ und Gästen, mit anschließender Diskussion
Dienstag, den 07. Oktober 2025 um 19.00 Uhr
studio Impro 97, Birkenstrasse 97, Düsseldorf
Buchempfehlung
Akademismus
Robert Olawuyi
Stimmungsatlas Bd. 37
Textem Verlag
Lesen Sie weiter
Spuren des Protests an der Kunstakademie Düsseldorf