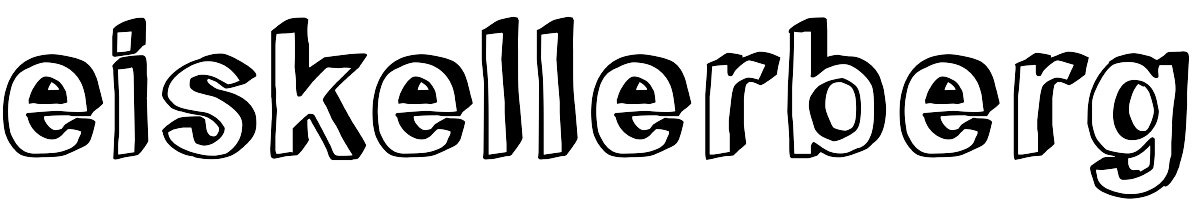Über die Kunst von Thomas Virnich ist viel geschrieben worden, Erhellendes, Verstellendes und sicher auch Kluges. Was wahrlich kein Wunder ist, da uns dieser Künstler doch nun über Jahrzehnte mit seinen Werken erstaunt oder verblüfft und auf eine verdrehte Art und Weise unser Herz erfreut. An die dreißig Kataloge halten sein vielgestaltiges und sich weiter entfaltendes Werk fest, so gut es Kataloge eben können.

Über seine besondere Nähe zum Spiel und wie er sich, ganz homo ludens, spielerisch die Welt, in der er lebt aneignet und so überhaupt erst zu seiner Welt macht, wissen wir Bescheid. Wie er alles und jenes als Material und Chance zur Materialumwandlung wahrnimmt, selbst das Schulgebäude in Möchengladbach, in dem er arbeitet und wohnt, seine Familie mit Kindern und Enkelkind, seine Klasse in der Kunstakademie Braunschweig, ja auch seine alltäglichen Belange. Alles wird seiner unablässigen Gestaltung unterzogen, alles wird Werk. Keineswegs zufällig, dass er seinen Lebensmittelpunkt in einer alten Schule gefunden hat, die in einem Ortsteil mit dem Namen Neuwerk liegt.
Weniger gewürdigt ist seine unbändige Lust am Zerstören und Zertrümmern, eine kindlich-spielerische Leidenschaft die zwischen Konstruktionen und Dekonstruktion bisweilen gefährlich schwankt.
Seine Lust am Gestalten schließt ein Geschehen-Lassen ein. So weit, dass die Fragmente, also das, was an einem vorläufigen Ende des sich oft über Monate hinziehenden Werkprozesses, nach Überformungen und Überarbeitungen, Verdrehungen und Zerschredderungen übrig bleibt, kaum mehr auf die Ausgangsform zurückführen lassen. Seinen Plastiken sieht man es an: Wie das Gelingen immer schon Anzeichen von Scheitern in sich birgt. Wie ein Kind aus Bauklötzen einen Turm baut, um ihn endlich umzustoßen.

Das Spielerische zeigt sich gerade in diesem Ablauf. Dabei sind das keineswegs zwei unterschiedliche, gar gegensätzliche Zustände, das Ganze und das Kaputte. Bei Virnich werden sie als Eins gezeigt. Wie Eins ins Andere übergeht, wird bei ihm sichtbarer Prozess und Verlauf. Wohin das läuft, überlässt er getrost dem Zufall, mal erscheint mehr das Hinfällige, mehr die kläglichen Reste und Trümmer, mal mehr die Form und die schöne Gestalt. Für den Bildhauer liegt darin ein Risiko und ein Gewinn. Er müsste genau wissen, wo dieses prozessorale Laufenlassen in ungeschlachten Klumpen, losen Trümmerhaufen endet, wo in Gestaltungen, die den Verlauf in ihrer zeitlichen Dimension erfassen. Das wäre der Gewinn. Denn die Zeit ist keine eigentliche bildhauerische Kategorie. Bildhauerwerke, Plastiken sind traditionell statisch, stabil und fest.
Das Feste fließt, das eben Errichtete fällt schon der Zerstörung anheim, das könnte man als Allerweltsweisheit und Banalität abtun. Aber gewiss liegt darin ein fundamental menschlicher Zug. Es ist Schicksal und Wesen dieser eigentümlichen Spezies. Ihre Kultur insgesamt lässt sich nicht von permanenter Zerstörung trennen. An solche Verhängnisse zu erinnern, darin liegt eine unheimliche Aktualität von Virnichs Schaffen. Indem er, wie vielleicht kein zweiter Bildhauer der Gegenwart, das Kind in sich bewahrt und kultiviert hat, gibt er uns einen Blick frei in diese allmächtig wirkenden Kräfte. Aber nicht als Blick in (den eigenen) Abgrund. Vielmehr stellen sie sich organisch verbunden, als vertrackt natürlich dar. Das könnte erlösend und befreiend wirken.

Weil sie Kinder so gerne hören, denkt sich Thomas Virnich immer neue Geschichten aus. Sie erzählen was. Sie nehmen einen Verlauf. Sie nehmen einen Anfang und finden ein (meist gutes) Ende.
Hier also:
Die Geschichte vom xxx in der Höhle des Löwen
Es war einmal ein xxx, der wollte in die weite Welt hinaus. So kletterte er auf einen Berg hinauf, den höchsten, den es in der Gegend, wo er aufgewachsen war, zu finden gab. Oben angekommen, war er sehr erstaunt und ergriffen von der Weite und der Schönheit der Landschaft zu seinen Füßen tief unter ihm. Flüsse, Straßen, Eisenbahntrassen zeichneten sich da als breite Bänder ab und verloren sich als immer schmaler werdende Linien in der Ferne. Er sah Wiesen und Wälder und andere, noch höhere Berge am Horizont aufragen. Selbst die Häuser, Autos und selbst die Menschen ließen sich erkennen. Von hoch oben sahen sie wie Spielzeughäuser, Spielzeugautos aus und die Menschen erschienen als kleine schwarze Punkte, die sich lautlos hin und her bewegten. Am Himmel ein Flugzeug, das schon beträchtlich größer erschien, als von unten gesehen und einen wesentlich größeren Lärm machte, so dass er unwillkürlich den Kopf einzog als es über ihn hinwegbrauste.
„So ist das also“, dachte er, verschwitzt, aber erleichtert: „Groß und Klein sind gar nicht groß und klein. Wenn man sich selbst nur von der Stelle bewegt, werden sie sogar das Gegenteil von dem, was sie zuvor waren. Ermutigt stieg er vom Berg herab, um endlich in die weite Welt zu kommen. Da sprang ihm ein Ungeheuer in den Weg und weil es ihm direkt vor die Füße sprang, erschein es ihn ungeheuer groß. Er wich zurück, das wilde Tier setzte ihm nach. So ging das hin und her, bis sich xxx erschöpft auf die Erde fallen ließ.
„Was willst du?“ fragte er. „Du kennst mich!“ fauchte das Ungeheuer. „Unmöglich“, antwortete er, „ich gehe ja gerade erst los.“ „Papalapapp!“, rief das Ungeheuer, „ich lasse dich nicht vorbei, bis Du mich in meiner Höhle aufgesucht hast.“ – „Was!“ schrie da xxx nach Leibeskräften, „in deiner Höhle!!!“ – Womit wir endlich bei dem Stichwort wären, auf den die lange Geschichte zulaufen solle. Denn Höhle ist so ziemlich das Gegenteil von „Weite Welt“, eng, dunkel, stickig, muffig, feucht und manchmal ist es auch sogar unheimlich da drinnen. Aus einer Höhle möchte man raus und so schnell es nur geht wieder ans Tageslicht; aus einer Höhle möchte man entkommen, fliehen – und das beileibe nicht nur im Märchen. Und doch ist es so, dass wer in die weite Welt hinaus will, oft in der Höhle landet. Nur wer den Löwen trifft, wird wieder herausfinden.
Bevor das Märchen weitergeht, sozusagen in der Pause, hier etwas zum Stichwort „Höhle“:
Höhlen spielen im Werk von Thomas Virnich von Anfang an eine große Rolle – und doch wird das oft übersehen oder zumindest unterschätzt. Höhlen sind Hohlformen, also das Negative der Formen. Die sind bei Virnich mindestens so präsent wie die Formen selbst. Sie kommen als Abdrücke, Auslassungen oder Aushöhlungen in allen erdenklichen Variationen vor. Etwa als Vertiefungen, Löcher, Blasen, sie entstehen durch Umstülpen, Ummanteln, Auskratzen, Zersetzen, Erosion. Es entstehen Grotten, Krater, Gräber, Stollen, Tunnel, Ruinen, Katakomben, fliegende oder gerade gelandete, überhaupt erscheinen die Zwischenräume, die Fehl- und Leerstellen mindestens so bedeutend wie die Körper, die Stützen und Säulen dazwischen. Höhlen kennen wir aus Philosophie, sie spielen seit der platonischen Akademie sogar eine gewisse Hauptrolle. Schließlich ist auch die Hohlform beim Bronzeguss eine Art Höhle, aus der nach dem Erkalten ein Bronzeberg entwächst. Es gibt Höhlen in der Natur, worum sich die Speläologie bemüht; fliegende Höhlen, genannt Flugzeuge und innere Höhlen. Auch graue Zellen sind gewissermaßen Höhlen. Aufnahmen von einem erkrankten Hirn erinnern uns an Tropfsteinhöhlen. „Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb“, dichtet schon der große Ringelnatz.
Bevor die Pause um ist, noch schnell einen Einwurf in eigener Sache: Ist die Höhle nicht eine Entgegensetzung zum Berg? Die Negativform zur Positivform? Genauer: den Berg durch die Höhle laufen lassen, wie das Denken durch das Sieb der Kritik laufen lassen. Merke: Sowohl die Tätigkeit des Siebens, wie der Begriff Kritik leiten sich vom griechischen „krinein“ ab. Ebenso wie Krise übrigens. Kritisieren ist also nichts anderes als Sieben, die „Spreu vom Weizen trennen“, oder Gold aus dem Sand waschen. Es handelt sich um einen Vorgang, beim dem ein Gedanke mit einer Geste korrespondiert, eine Geste mit einem Werkzeug, ein Werkzeug mit einem Material, das es zu „sieben“ gilt. Das Werkzeug nennen wir Dialektik, die Geste die Negativität. Aber was ist der Staub, der während des Siebens aufsteigt, uns die Sicht nimmt, aber weder Spreu noch Weizen ist?
Was blieb ihm übrig? Das Ungeheuer erwies sich als unbezwingbar und unnachgiebig. Also nimmt sich xxx ein Herz und macht sich todesmutig auf den Weg in die Höhle, die sich tief im Berg befindet. Der Eingang ist schnell gefunden, die Höhe größer als erwartet. Er läuft hinein, tiefer als er will und viel tiefer als er es sich zutraut. Um sich Mut zu machen ruft er so laut er nur kann und es hallt umso lauter zurück. Aber wo ist der Löwe? Wieder ruft er aus Leibeskräften und wieder brüllt es ohrenbetäubend zurück. Er war nun mitten in der Höhle des Löwen.
Der Staub, der aufwirbelt, ist vielleicht unsere Sehnsucht, unsere Hoffnung. Wir sehen kaum mehr weit, wir reiben uns die Augen. Unser Verlangen nach klarer Sicht aber ist wach.
Bilder und Figuren sind manchmal schön, manchmal mächtig, doch gleichzeitig zerbrechlich, fragil. Sie taugen wenig für die Allgemeinheit des Begriffs, sondern sind stets einzigartig, auf einen bestimmten Ort bezogen, sind lückenhaft, porös, mikrologisch. Zugleich sind sie in alle Richtungen offen, niemals völlig in sich geschlossen. Eher Höhlen denn Berge. So sind sie wahr als Fragment, als Zwischenraum, als Hülle und offene Höhle. So versetzen sie uns unerfüllt in Unruhe.
Tastend suchte xxx den Weg nach draußen. Etwas ratlos stand er wieder am Eingang der Höhle. Wo war das Ungeheuer? Was hatte das zu bedeuten? Wohin wollte er noch wandern?
Carl Friedrich Schröer
Doppelausstellung
Zwischen Raum
Galerie Michael Haas
Niebuhrstr. 5, 10629 Berlin
und
Kunst Lager Haas
Lise-Meitner Str. 7-9, 10589 Berlin
25. Nov. 22 bis 15. Jan. 2023