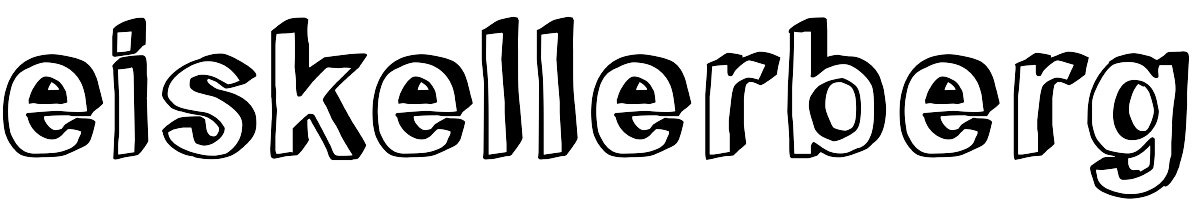von Carl Friedrich Schröer
Ein Traum: eine fremde (befremdliche) Kunst kennen und sie dennoch nicht verstehen. In ihr die Differenz wahrnehmen, ohne dass diese Differenz jedoch jemals durch Kommunikation oder Gewöhnlichkeit der Sprache eingeholt und eingeebnet werden könnte. In einer neuen Sprache positiv gebrochen, die Unzulänglichkeiten der meinen erkennen, die Systematik des Unbegreifbaren erlernen, meine „Wirklichkeit“ unter dem Einfluss anderer Einteilungen, einer anderen Syntax auflösen; die unerhörte Stellung des Subjekts entdecken, deren Topologie verschieben; mit einem Wort, ins Unübersetzbare hinabsteigen und dessen Erschütterungen empfinden, ohne es je abzuschwächen, bis der ganze Okzident in mir ins Wanken gerät… wäre mein (vielleicht nur im Traum erreichbares) Erstaunen und Verstummen beim Betreten des (hoffentlich immer) fremden Planeten Kunst.
Roland Barthes hat es auf einer Reise nach Japan erfahren (und in seinem phantastischen Buch über den Reichtum der unverständlichen Schriftzeichen, „Das Reich der Zeichen“ aufgeschrieben):
„Wenn ich mir ein Volk ausdenken will, kann ich ihm einen erfundenen Namen geben, kann es erläuternd als Romangegenstand behandeln, eine neue Garabagne gründen, um kein wirkliches Land in meiner Phantasie zu kompromittieren… Ich kann auch ohne jeden Anspruch, eine Realität darzustellen oder zu analysieren, irgendwo in der Welt eine gewisse Anzahl von Zügen (ein Wort mit graphischem und sprachlichem Bezug) aufnehmen und aus diesen Zügen ganz nach Belieben ein System bilden.“
Ich folge Barthes (Begründer des Poststrukturalismus …verwendete die Methoden des Strukturalismus und der Dekonstruktion, aber auch der Psychoanalyse, um moderne gesellschaftliche Phänomene wie Texte, Filme, Fotografie, Mode, Werbung oder die Liebe zu untersuchen. Als Kritiker löste er oft scharfe Auseinandersetzungen aus – Wikipedia) und denke mir einen fiktiven Künstler aus, erfinde einen Namen und unternehme so eine Reise ins unbekannte Garabagne.
Mein Künstler kommt aus Japan, ein Land, das mir vollkommen fremd ist, heißt Ayumi Yamada, ist also eine Künstlerin. Das Fremde löst, einem Erdbeben vergleichbar, eine Erschütterung der Sinne (und des Sinns) aus wie ein satori (das Zen-Erlebnis), das die Erkenntnis, das suchende Subjekt ins Wanken bringt: Es bewirkt eine Leere in der Sprache. Von dieser Leere ausgehend, könnte eine neue Sprache erfunden werden, die fähig wäre, das Unbekannte zu erfassen.
In der japanischen Tradition bedeutet satori eine Intuition, die wiederum vollkommen verschieden ist von dem, was gemeinhin Intuition genannt wird. Satori siedelt jenseits der Grenzen des Ich. Es ist eine Synthese von Gegensätzen, von Bejahung und Verneinung, von Sein und Werden, von mystischer Erfahrung und dem täglichen Leben, von nah und fern. Dem strebt auch Ayumi nach. Die Künstlerin und ihr Werk sind nicht mehr zwei entgegengesetzte Dinge, sondern eine einzige Wirklichkeit.
Hier berühren wir die tiefere Beziehung zwischen Zen und der Kunst Ayumis. Zen ist „das tägliche Bewußtsein“, wie Baso Matsu ( gest. 788) es ausdrückt, auch „ das Erwachen vor der Tatsache“, ein Ergriffensein von der Sache als Ereignis (und nicht als Substanz). Es ist nichts anderes als „schlafen, wenn man müde ist, essen, wenn man hungrig ist.“ Sobald wir überlegen, urteilen und Begriffe bilden, geht das ursprünglich Unbewusste verloren und Gedanken stellen sich ein: Wir essen nicht mehr, wenn wir essen, schlafen nicht mehr, wenn wir schlafen. Die Künstlerin beginnt zu reflektieren und zu kalkulieren und ihr Werk verrutscht ins Gemeine.
Kindlichkeit musste sie nach langen Jahren der Übung in der Kunst des Sich-Selbst-Vergessens erst wieder erlangen. Dann denkt Ayumi und denkt doch nicht. Sie denkt wie der Regen, der vom Himmel fällt; sie denkt wie die Woge, die auf dem Meere treibt, sie denkt wie die Sterne, die den nächtlichen Himmel erleuchten, wie das frische Grün, das unter dem milden Frühlingswind aufsprießt. Sie ist dann selbst der Regen, das Meer, die Sterne, das Grün. Spät erst hat die Künstlerin diese Stufe der „geistigen“ Entwicklung erreicht, nun braucht sie nicht mehr Leinwand, Pinsel und Farben. Ihre Hände und Füße sind die Werkzeuge und das ganze Weltall ist ihr Material. Jetzt erwächst ihr Können aus einer „nichtgekonnten Kunst“. Sie entsteht selbstlos und ungezwungen, fast beiläufig und in völliger Bescheidenheit und Ayumi ist eins mit der Vollkommenheit ihrer technischen Geschicklichkeit. Sie zielt nichts mehr an, nichts setzt auf Fortschritt oder Innovation, nichts auf Inhalt oder gar überlegene Moral. Alles entsteht.
Es ist ein Spiel, der Einsatz ist hoch; es ist existentiell, es zielt auf sie selbst. Wer es nicht spielerisch betreibt, hat schon verloren. Es ist beileibe kein Zeitvertreib, keine „Petitesse“, keine harmlose Bastelei. Es ist ein Spiel und es geht um Leben und Tod.
So beiläufig und alltäglich es erscheint, der Zugang, darin stimmen alle Zenmeister überein, ist nur denen vergönnt, die „reinen Herzens“ sind, von Nebenabsichten unbekümmert. Der Weg in die Kunst geht über die kunstlose Kunst. Was sollte das sein? Wie wollte man das unterscheiden? Das Armselige und Beiläufige, das Unscheinbare und Unattraktive, das Wertlose, das Ach-So-Alltägliche von “kunstloser Kunst”? Das Wesen der „kunstlosen Kunst“ liegt im Nicht-Machen-Wollen, nicht im Schaffen und Erschaffen, vielmehr im absichtslosen Zulassen und unbefangenen Gelingen. Auch Ayumi Yamada hatte sich auf den Weg zur kunstlosen Kunst gemacht, um am Ende die kunstlose Kunst selbst zu werden, Meisterin und Nichtmeisterin in einem. Sie hatte die Anweisung ihres Lehrers befolgt: „Beobachte zehn Jahre lang Bambus, werde selber zum Bambus, vergiß dann alles und – male.“ Und doch ist dieses Unmögliche eines Tages möglich, ja selbstverständlich geworden. Wie das? Übung. Und Geistesgegenwart. Und immer von Neuem muss sie Schülerin und Anfängerin werden, das letzte, steilste Stücks des Weges gehen, durch neue Wandlungen hindurchgehen.
Aber nicht alles Arme und Alltägliche ist kunstlose Kunst. Nicht jede Fundsache ist ein Readymade, nicht jede Suppendose eine Ikone der Popart. Nicht jede fein arrangierte Materialcollage ist Ausdruck dieses „Unmöglichen“. Wie ließe sich das bloß unterscheiden? Mit dem Herzen. Jeder, der Ayumis Kunst offen begegnet, wird von ihr angerührt, sie wird ihn unweigerlich verändern. „Nichts Besonderes“, sagt Barthes vom Haiku. „Der Blitz des Haiku erleuchtet, enthüllt nicht; er ist der Blitz eines Photos, das man mit größter Sorgfalt (auf japanische Art) aufnähme, während man doch vergessen hätte, einen Film einzulegen.“
Der alte Teich:
Ein Frosch springt hinein
Oh! Das Geräusch des Wassers

Inge Schmidt dagegen war nie in Japan. Mit Zen hat sie überhaupt nichts am Hut. Mit Esoterik auch nicht. Nach ihrem Studium bei Michael Croissant kam Schmidt 1981 nach Köln. Dort wohnt und arbeitet sie seither. Eigentlich nur in einem Stadtteil. In Nippes wohnt sie und in Nippes unterhält sie ihr Atelier. Seit über 40 Jahren nun. Morgens macht sie sich auf den Weg, meist zu Fuß, manchmal mit dem Fahrrad. Die tagtägliche Arbeit (die genauso gut Nicht-Arbeit ist) beginnt mit diesem Weg. Manchmal hält sie an, wenn ihr auf dem Weg Dinge auffallen, Reste, Liegengelassenes, an den Straßenrand Gestelltes. Die Fundstücke nimmt sie mit in ihr Atelier, wo sie fünf, sechs auch sieben Stunden verbringt, sitzt, aufräumt, hantiert, sich verliert. Man könnte es eine Übung nennen, eine Versenkung.
Ihre Werkstatt ist voller Dinge, Ansammlungen von Materialien auf dem Boden, in den Regalen, auf Tisch und Bänken: Holzlatten, Wellpappe, Draht, Schnüre, Stoffreste, Papiere… samt und sonders wertloses „armes“ Material, selten Gips oder Ton. Dazu eine dicke Staubschicht, Spinnweben und manchmal Insektenlarven. Die Bildhauerin setzt alle diese Nichtigkeiten und Fundsachen liebevoll zusammen, sie rettet sie aus der Bedeutungslosigkeit.

Aus Wellpappe, bemaltem Papier und Kordel entsteht „Fühlhand“. An einem Nagel hängt an einem blauen Plastikstrick „Hand mit Blau am Nagel“. Aus fünf Hölzchen und einem Stoffrest wird „gelber Rock“. Aus Draht und zwei Holzresten wird, schwer entzifferbar, ein Schriftsatz „lieb + böse“. „Die Standhafte“ steht auf nur einem krummen Bein. Der „konkrete Schritt“ steht auf einem Gipsfuß, streckt aber einen weiß getünchten Holzstab weit in die Welt hinaus. Das „Kufentier“ gleitet auf seiner einzigen Kufe, hält zur Sicherheit ein drittes Bein heraus und zeigt menschliche Züge. Mit einer Höhe von 29 Zentimetern zählt es zu den größten von diesen Werken. Das „ausgebüxte Lila“ misst nur elf Zentimeter.
Große Kunst? Schwer zu sagen, wo alles so leicht und beiläufig wirkt, auch lustig und ungelungen, gezeichnet vom Scheitern, instabil und fast schon auf der Kippe zum Kinderkram. Oder auch hier eine in jahrzehntelanger Übung gewonnene Kindlichkeit? Ein Können, das aus dem tagtäglichen Sich-Verlieren eine Heiterkeit rettet und eine „nichtgekonnte Kunst“ gewinnt? Das Fragezeichen können wir getrost weglassen.

Für den Aufbau ihrer Ausstellung in der alten Unternehmervilla Zanders bekam Inge Schmidt 14 Tage eingeräumt. Nach sieben Tagen stand alles. Sieben volle Tage für acht hohe Räume, 339 Werke, Künstlerbücher, Zeichnungen, Wandstücke, Bodenarbeiten, Objekte, Kollagen, Skulpturen, Modelle für wer weiß was. „Dann stand alles dort, wo es mich hingeführt hat.“ Schmidt übernachtete in ihrem Bus auf dem Parkplatz vor dem Kunstmuseum. Bis sie das Gefühl hatte, „es stimmt. Die fangen an, miteinander zu plaudern. Zumindest in der Nacht, wenn sie allein sind.“ Beim Aufbau ergaben sich neue Beziehungen, ein nicht planbares Ineinanderhaken über Raumgrenzen hinweg. Ein Beispiel: Im zentralen Raum reckt ein kniehohes Bündel aus der Bodengruppe sein struppiges Haarbüschel keck empor. Fällt der Blick zurück an die Rückwand im benachbarten Raum, trifft er dort auf „hohes Gesträuch“, das oben auf einer Konsole Platz gefunden hat. Es ist hier nicht allein die formale Korrespondenz der beiden Objekte, die Schmidt ins Feld führen will. Es geht ihr um eine Öffnung der Dimensionen. Gering steht neben bedeutend, sich hervortun neben sich verstecken, witzig neben ernst, attraktiv neben aschgrau. „Nicht alles ist auf gleicher Höhe“, sagt die Künstlerin. Bodenstück und „hohes Gesträuch“ kommen sich vergnügt in die Quere. Das Spiel wäre eröffnet: „Rotnase“ und „gelochte Ovalfrau“, „Profilneurose“ und „Paarung“, „falsche Giraffen“ und „großer Märzleib“, 339 sonderliche Stücke, merkwürdige Gestalten, aus dem Gleichgewicht geratene Akrobaten warten auf ihre Entdeckung als Protagonisten im Zirkus Imaginaire.







Inge Schmidt – an der Wand und vor und neben
Kunstmuseum Villa Zanders, Bergisch Gladbach
bis zum 24. Juli
Weitere Beiträge