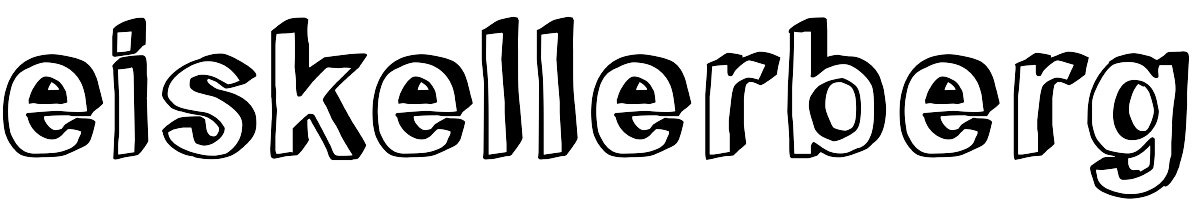Ratzfatz. Schneller als gedacht, kratz Rein Wolfs die Kurve und nimmt die Chance seines Lebens wahr: Noch einmal, kurz vor Vollendung seines 59. Lebensjahrs, ein großes Kunstmuseum aus der Krise führen.
Der hochgewachsene Kunsthistoriker, 1960 in der alten Hafenstadt Hoorn an der holländischen Zuiderzee geboren, wollte dem Ruf des Stedelijk Museum nicht widerstehen. „Da sagt man doch nicht Nein.“ Im Oktober 2017 hatte Beatrix Ruf ihren Posten dort räumen müssen. „Ich kenne das Museum seit meinen Kindertagen“ erinnert sich Wolfs gerne. „Ich hoffe nun über die Erfahrung und die Unterstützung zu verfügen, die nötig sind, um dieses Haus mit seiner revolutionären Geschichte und seiner unglaublichen Sammlung in eine bessere Zukunft zu führen.“ Das angeschlagene Haus am Amsterdamer Museumplein hätte keinen versierteren Direktor finden können.
16 Millionen Euro lässt sich der Bund seine „Kunst- und Ausstellungshalle“ pro Jahr kosten. Rund vier Millionen spielt das mit drei Spitztürmen bewehrte Haus dazu ein – solange weiterhin 500.000 Besucher im Jahr zu den Ausstellungen kommen, Eintritt zahlen, Kataloge kaufen, den „Speisesaal“ frequentieren, oder beispielsweise der Deutsche Ärztetag das Forum anmietet. 20 Millionen Euro Etat für eine Ausstellunghalle insgesamt ist einsame Spitze, auch in Europa konkurrenzlos.
In Berlin, von wo aus die Bundeskunsthalle politisch gesteuert wird (Monika Grütters offizieller Dienstsitz ist Bonn, auch wenn sie aus dem Kanzleramt in Berlin, ihrem zweiten Dienstsitz agiert) wusste man Wolfs Gelassenheit stets zu schätzen. Sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2023 verlängert. Half nichts. Zum 1. Dezember verlässt Wolfs den Riesentanker an der Bonner Museumsmeile. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Bewerbungsschluss war schon am 15. August.
„Wir sind breit aufgestellt“, wiederholt Intendant Wolfs sein Mantra. Was sonst? Eine auf Kunst allein festgelegte Halle, könnte kaum eine halbe Million Besucher im Jahr bewegen. Das ist am Stedelijk anders. Doch ist Wolfs Profi genug, um den Erwartungen in Amsterdam vorzubauen: „Es ist ein ehrgeiziges Museum, dass noch sogar noch breiter werden kann, menschlicher und internationaler und auch eine Rolle in der sozialen Debatte führen kann“.

Ein Gespräch zum Abschied mit Rein Wolfs
„Bitteschön, Dankeschön“ so der Titel der aktuellen Kippenberger Ausstellung, klingt wie ein Abschiedsgruß am Ende Ihrer Ära. Planung oder Zufall?
RW: Der Titel war ein Vorschlag der Kuratorin und hatte nichts mit meinem Abschied zu tun. Im Nachhinein finde ich ihn aber tatsächlich sehr passend.
Warum ausgerechnet eine Kippenberger Retrospektive? – Kippenberger ist ja nicht unbedingt ein Staatskünstler.
RW: Das ist in erster Linie die Leistung von der Kuratorin Susanne Kleine. Sie hat mir gleich zu Beginn im Jahr 2013, als ich hier gerade angefangen habe, gesagt, dass sie gerne eine große Kippenberger Ausstellung machen möchte. Es folgte zunächst die Ausstellung zu Kippenberger im Hamburger Bahnhof. Wir beschlossen, noch ein paar Jahre zu warten, um das Thema neu zu denken.

Ist ja eine Steilwand, Kippenberger.
RW: Schön steil. Ich bin sehr glücklich, dass wir diese steile Wand meistern konnten. Er ist ein Künstler, der uns in der Bundeskunsthalle in der Reihe der großen deutschen Maler und Künstler der 80er und 90er Jahre natürlich noch gefehlt hat. Kippenberger hat diese besondere Herangehensweise, bei der sich Humor mit großem Tiefgang vereint. Dass er sich in seiner Kunst nicht festlegen ließ und wollte, ist für mich letztendlich auch ein interessantes und zugleich aktuelles Statement. Es war nicht als Abschiedsstatement intendiert, aber ich finde es passend.
Macht ja den Spielraum der Bundeskunsthalle aus, dass Sie nicht nur staatstreu sind, sondern auch Außenseiter, auch Anti-maler vorstellen.
RW: Es geht auch hier letztendlich um die Freiheit der Kunst. Darum ist es mir immer gegangen. Das ist heute keineswegs selbstverständlich. Wir setzen uns Gegenwind aus. Zum Beispiel Michael Jackson – Sollten wir selbst die Rezeption Jacksons ausstellen? Dürfen wir das? Ich habe klar gesagt, dass wir das zeigen müssen! Wir müssen die Kunst, die über ihn entstanden ist, zeigen. Bei Kippenberger stellt sich die Frage für mich gar nicht, ob das Staatskunst ist oder eben Anti-Staatskunst. Sie ist nicht relevant für die Entscheidung, ob man ihn ausstellt oder nicht. Wir beziehen unsere Zuwendungen aus dem Etat der Beauftragten für Kultur und Medien, Monika Grütters. Aber deshalb machen wir doch längst keine linientreuen Ausstellungen. Auf gar keinen Fall.
Es gab ja mal ein regeres Zusammenspiel mit dem Gropius-Bau in Berlin. Das ist zuletzt etwas eingeschlafen. Warum?
RW: Die letzte Ausstellung, die wir im Gropius Bau gezeigt haben, war die Ausstellung. Bestandsaufnahme Gurlitt vor gut einem Jahr. Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft auch wieder Zusammenarbeiten zwischen Bonn und Berlin geben wird Wir sind Partner und werden als solche auch zukünftig in Gesprächen schauen, ob es gemeinsame Projekte von aktueller Relevanz geben kann.
Nicht Goethe, nicht die zerstörten syrischen, irakischen und libyschen Ausgrabungsstätten. Hätte man ja gerne in Berlin auch mal gesehen.
RW: Der Gropius Bau hat mit Stephanie Rosenthal eine neue Direktorin. Sie hat ein eignes Programm auf die Beine gestellt, wodurch sie das Haus anders profiliert. Auch deshalb kam es bisher zu keiner Zusammenarbeit. Die innerdeutschen Zusammenarbeiten habe ich immer als sehr zielführend gesehen, ob mit dem Gropius Bau, der Klassikstiftung Weimar oder mit den Fürst-Pückler–Parks und Museen in Bad Muskau, Branitz und Potsdam. Zudem haben wir eine Hanne Darboven-Retrospektive in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kunst in München gemacht. Zurzeit arbeiten wir eng zusammen mit dem Beethovenhaus hier in Bonn, Mitte Dezember eröffnen wir gemeinsam die zentrale Beethoven-Ausstellung Welt.Bürger.Musik. Unserer Ausstellung zum Beethovenjubiläum folgt im nächsten Jahr übrigens eine Ausstellung im BOZAR in Brüssel. Es wird eine Folgepräsentation von uns dort konzipiert.
Nicht in Berlin?
RW: Nicht in Berlin in diesem Fall.

Möchten Sie rückblickend sagen, was Ihre drei besten Ausstellungen waren?
RW: Natürlich ist mir die Bestandsaufnahme Gurlitt sehr stark in Erinnerung geblieben und wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wir haben sehr lange und intensiv daran gearbeitet. Ich bin persönlich mit dem Ergebnis sehr glücklich gewesen. Auch mit dem Narrativ, den wir durch den „Kunstfund Gurlitt“ entwickeln und letztendlich präsentieren konnten. Auch die Marina-Abramovic-Retrospektive ist mir sehr, sehr wichtig gewesen. Die Künstlerin hatte ich stets im Blick, wollte sie immer präsentieren und dieser Wunsch ist hier in der Bundeskunsthalle zu einer großartigen Ausstellung gereift. Eine Ausstellung, mit der wir ein performatives Konzept ins Haus gebracht haben, was sehr stark publikumsbezogen war. Die Rückmeldungen und die Art und Weise, wie Menschen damit umgegangen sind waren mir sehr wichtig und sehr tiefgreifend. Eine dritte Ausstellung, die für mich sehr bedeutend wurde, war die Pina Bausch-Retrospektive. Sie war die erste große Ausstellung zum Oeuvre Pina Bauschs überhaupt. Eine Ausstellung, bei der wir gemeinsam mit der Pina Bausch Foundation ein Konzept entwickeln konnten, um aus performativer Perspektive ein Format für die Besucher selber zu kreieren. Es waren regelmäßig Tänzerinnen und Tänzer aus dem Ensemble in der Ausstellung anwesend, die mit Besucherinnen und Besuchern Tanzübungen und -workshops machten. So konnte jede und jeder durch Ausprobieren ganz persönlich erfahren, worin die Meisterschaft und Magie im Tanz bei Pina Bausch bestand. Ganz am Anfang meiner Intendanz war die Kasimir Malewitsch-Retrospektive eine besonders gemeisterte Herausforderung, übrigens aus dem Stedelijk Museum in Amsterdam übernommen, was mir damals sehr wichtig war, weil das Stedelijk Museum bei Weitem die größte Malewitsch-Kompetenz im Westen hat. Auch die Schau zu Ferdinand Hodler fand ich sehr geglückt.
Abramovic und Bausch sind Formate, die sich für eine Ausstellung nicht unbedingt eignen. Das verlangt eine eigene kreative Annäherung. Eine Herausforderung, die sie suchen?
RW: Das hat mich gereizt, sicher. Das Haus hier ist hinsichtlich der Vielfalt und Programmatik breit aufgestellt und bietet größte Freiheiten, sich mit solchen Formaten auseinanderzusetzen. Wir haben die Frage versucht zu beantworten, was eine Ausstellung ist. Was bedarf es, um das Schaffen mit seinen Herausforderungen in eine Ausstellung zu übersetzen. Ganz wichtig bei Pina Bausch. Wir haben lange miteinander diskutiert, wie das Thema auszustellen ist. Auch bei der Goethe-Ausstellung haben wir diese Frage gestellt. Jede Ausstellung fordert ein anderes Konzept. Wenn etwas aus der Kunst heraus kommt, entwickelt sich das Ausstellungskonzept gewissermaßen von selber. Man fängt an, einen imaginären Raum mit den Kunstwerken zu entwerfen, aus dem sich eine Ausstellung ergibt. Wenn aber keine Kunstwerke , sondern anderes Ausgangsmaterial vorhanden ist, muss man neu denken. Erstens muss es fesselnd präsentiert, zweitens der Sparte gerecht werden, drittens muss der Blick auf die Besucherschaft vollzogen werden: Wie biete ich die größtmögliche Identifikation und präsentiere möglichst für alle zugänglich, verständlich und zugleich ästhetisch ansprechend? Darin bestand bei Pina Bausch sicher die schwierigste Herausforderung.
Sie haben sich gerade erst richtig warmgelaufen in Bonn. Eigentlich müssten sich die Bewerber, die sich gerade in Berlin um Ihre Nachfolge bewerben, erstmal sich bei Ihnen erkundigen wie so ein Großtanker zu lenken ist. Was könnten Sie denen mit auf den Weg geben?
RW: Das Haus hat ungeahnte Möglichkeiten. Das Haus kann viel breiter arbeiten, als ein Kunstmuseum es machen kann. Man kann hier Ausstellungen zu komplett anderen Themen machen, die auch kunstfern sind. Das finde ich großartig. Die gerade beendete virtuelle Ausstellung Von Mossul nach Palmyra hat doch gezeigt, dass man auch die Thematik und das Display von archäologischen Ausstellungen neu denken kann. In Bonn hat für mich die große Möglichkeit bestanden, Vielfalt im Sinne von Programmvielfalt auszugestalten, zu versuchen, diesen Begriff positiver zu besetzen. Ich finde es gelungen, letztendlich.

Der Weg von Hoorn nach Amsterdam ist ja nicht allzu weit.
RW: Von Hoorn nach Amsterdam sind es 50 Kilometer. Die größte Stadt in der Nachbarschaft von Hoorn ist Amsterdam. Da studiert man.
Sie haben es weit gebracht, sind nun doch wieder in der Nachbarschaft gelandet.
RW: Ungeahnt, ja.
Ein Heimkehrer. Freut Sie das besonders?
RW: Ich habe nicht gedacht, dass ich nochmal nach Holland zurückkehren werde. Ich habe mich in Deutschland sehr wohl gefühlt. Aber widerstehen konnte ich auch nicht. Mit meinen Eltern fuhren wir zwei-, dreimal im Jahr nach Amsterdam. Dann gingen wir oft im Stedelijk Museum vorbei, Kunst schauen. Es ist auch das Museum meiner Studentenzeit. Das ist das Referenzmuseum, sozusagen. Und natürlich legt man die Messlatte für sich selber hoch, wenn man dann das Gefühl hat, dass man an diesem Ort nun selbst etwas erreichen kann. Mal schauen.
Was interessiert Sie noch an der Kunst heute?
RW: Mich interessiert aktuell an der Kunst, wie sie ethische Fragen verhandelt. Gewisse Künstler stellen breitere Frage. Ob Fragen der Globalisierung, der Interkulturalität, Fragen zu Sponsoren und auch zur Art und Weise, wie ein Museum heute geführt wird. Es gibt viele große Fragen, die wieder neu im Raum stehen. Die Kunst steht wieder etwas näher an der Realität, würde ich behaupten.
Kunst wird aber auch in ihrer Freiheit stärker ethisch eingehegt, ihre Autonomie in Frage gestellt.
RW: Sicher muss man hier und da die Frage stellen, ob die Autonomie eingeschränkt wird. Ich bin selber aber so gestrickt, dass ich immer den Spannungsbogen suche, auch im Museum. Das Stedelijk ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst und Design. Mich interessiert das Miteinander das Miteinander und wie es sich gegenseitig befördert. D.h. einerseits auf die kunstimmanenten Qualitäten von modernistischen Positionen zu schauen, andererseits aber auch im zeitgenössischen Kontext mit immersiven und mit erfahrungsbezogenen Projekten umzugehen.
Auch performative Kunst im Übergang zu Film und Video, zu Bewegung, zur digitalen Welt?
RW: Das interessiert mich sehr. Das Stedelijk ist ein Museum, das als eines der ersten Museen der Welt angefangen hat, Performance-, Video-, und Konzeptkunst zu sammeln. Wir haben da eine Kuratorin nur für die Time-Based-Media. Das möchte ich wieder mehr herausstellen. Ich möchte die Anfangszeiten der Performance- und Konzeptkunst wieder ins Bewusstsein rufen und mit heute vergleichen.
Wagen Sie einen Ausblick in die digitale Welt?
RW: Das ist etwas, das wir im Sammlungsbereich bereits versuchen. Ich werde es vertiefen. In Deutschland ist Digitalisierung momentan das Zauberwort für Transparenz, nicht wahr? Das hängt stark mit der Restitutionsproblematik zusammen, auch mit der Frage, wie wir den Wirkungskreis des Museums verbreitern können. In Holland ist das bisher etwas „natürlicher“ umgesetzt worden. Ich möchte einmal genauer unter die Lupe nehmen, wie wir noch stärker Digital Natives an das Museum binden können.
Danke fürs Gespräch. Bedankt en tot ziens!

Redaktion: Anke Strauch
Mehr zum Thema
Der ideale Intendant – Rein Wolfs bringt die Bundeskunsthalle wieder auf Kurs
Ruhe im Karton – Die Bundeskunsthalle in Bonn feiert 25 Jahre Überstehen