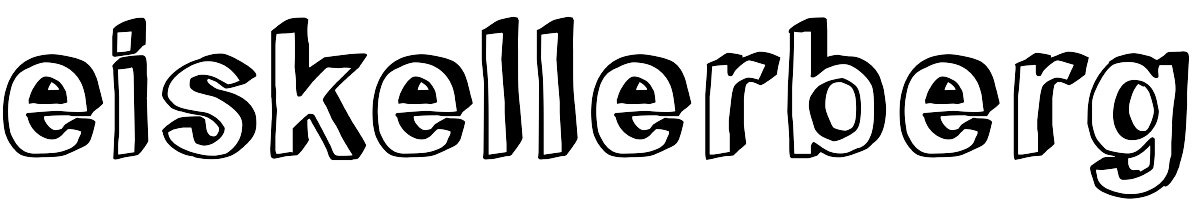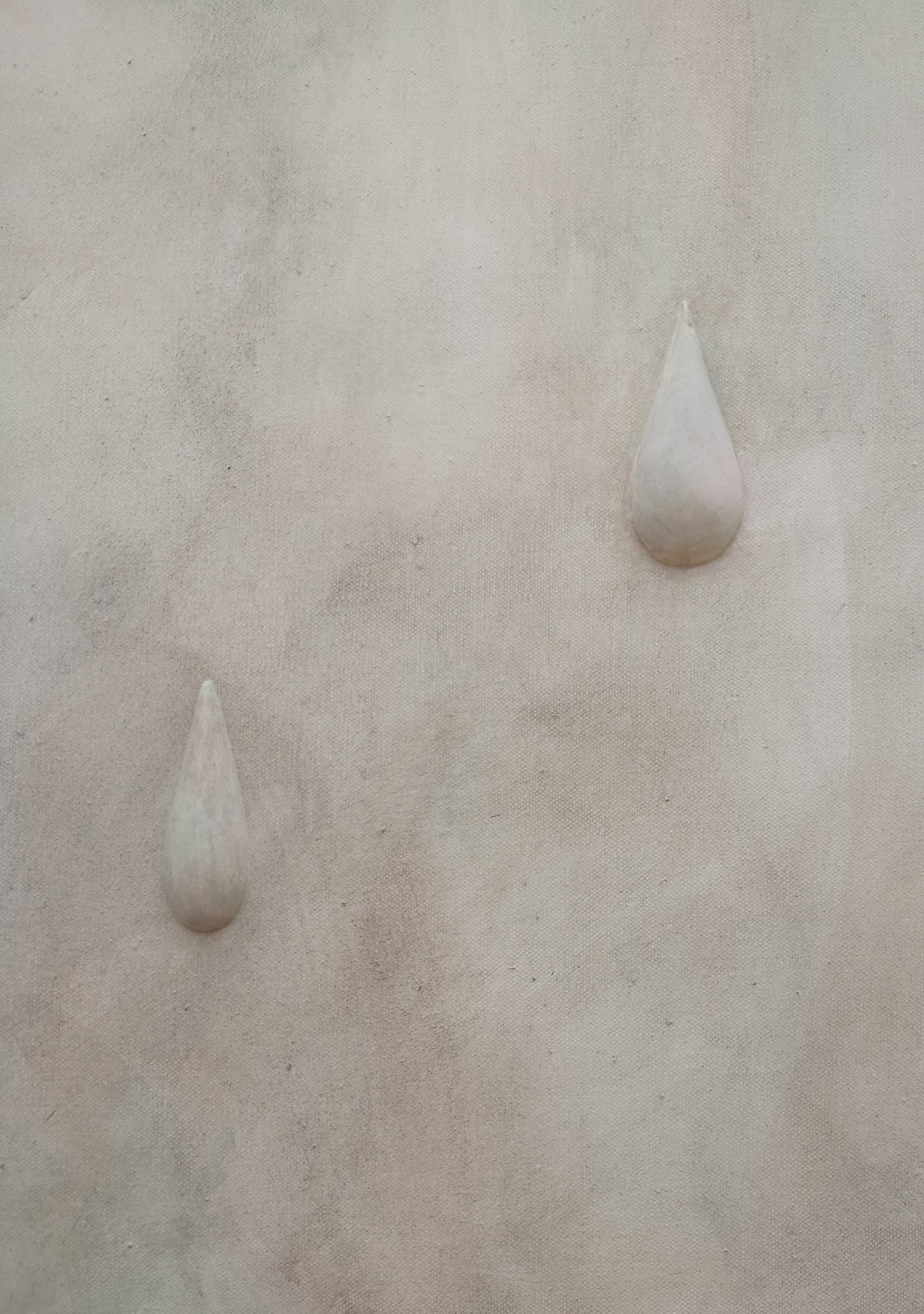Farbknäuel, aus kleinen und größeren Pinselstrichen neben- oder übereinander gesetzt, bilden feingliedrige, flirrende Farbstrukturen. Hellkreidige Spuren in freien, strichartigen Pinselzügen führen ihr Eigenleben. Aus der Nähe ein flüchtig angehäuftes Chaos kleiner Bewegungen, aus der Distanz wolkig aufbauende Strukturen und größere Farbverschiebungen, die von den Bildrändern aus gesehen als dunkelblaue oder tiefgrüne Schattenzonen in die Mitte wandern. Dort werden sie von aufhellenden Farbtexturen durchsetzt, die wie Lichtreflexe aufschimmern. Der Unterschied zwischen Pinselspur und Objekt ist bis an den Rand des Lesbaren aufgehoben. Dinghaftes lässt sich nur erahnen. Ein fast teppichartiger ins Abstrakt-Dekorative verweisender Effekt stellt sich ein.
Wir bewundern hier das große Seerosen-Triptychon des altehrwürdigen Claude Monet, nicht etwa eine Arbeit des 1956 in Meran geborenen Malers Rudolf Stingel. Monets „Seerosenweiher“ von 1917-1920 bildet den Auftakt, die Vorlage, auch die malerische Herausforderung der Stingel-Schau. Es bildete auch den Grundstock der Sammlung von Ernst Beyeler, dessen Stammsitz mittlerweile als das meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz gilt. Sein Monet war für den Stifter ein Grund, ein Museum von Renzo Piano (u.a. Centre Pompidou, Paris (1977), Zentrum Paul Klee, Bern (2005), zuletzt „The Shard“, London) entwerfen zu lassen.
Doch wie ungetrübt ist unser Blick auf dieses Werk noch? Unzählige Reproduktionen des Motivs haben es verbraucht. Druckvarianten hängen massenhaft in Privatwohnungen, Schulkinder malen es im Unterricht nach. Die Seerosen, längst abgesunken zu visuellem Müll? Und doch gewinnt dieser Monet im lichten Piano-Haus eine geradezu widerspenstige Kraft und Intensität.
Stingel nimmt das als Herausforderung wahr – und läßt seine Inszenierung unmittelbar an der räumlichen Schnittstelle zu Monet und den anderen, altbekannten Malerheroen der klassischen Moderne beginnen.
Mitmachmalerei
So beginnt der Ausstellungsparcours mit kraftvoll gesetzten Eyecatchern. Sie ziehen nicht nur optisch und mental in ihren Bann, sondern animieren uns auch zum Mitmachen. Eine große Querwand wird von übergroßen Teppichhälften mit leicht verrutschenden, vertrauten persischen Mustern in Schwarz-Weiß bedeckt: eigenständige Bildfindungen oder Spiele mit Reproduktionen und ihrer Verfügbarkeit? Sie kontrastieren stark mit den benachbarten Wandflächen, die einem silberglänzend und ästhetisch reizvoll entgegentreten. Sie werden von handelsüblichen Dämmplatten, von reflektierenden Folien überzogen, bekleidet. Der Künstler gibt sie zur Benutzung und Abnutzung frei und zieht sich aus dem kreativen Prozess zurück. Es entsteht eine wand- und raumfüllende Tafel, die das Publikum bearbeitet. Sie wird bekritzelt und beklebt, mit Tags und üblichen Alltagskommentaren versehen, wie sie überall im öffentlichen Raum zu finden sind. Man stößt auf wenig Sinnhaftes oder Bedeutungsschweres. Erwachsene Besucher geben sich gelassen, jüngere finden einen heillosen Spaß daran, die Silberhaut aufzubrechen und das gelbkörnige Material darunter herauszufingern. Landschaften aus offenen Mustern mit Kratern und Tälern entstehen. Auch auf den im Raum platzierten Tischen mit Stapeln des zur Ausstellung herausgegebenen Künstlerbuchs darf derart gewerkelt werden. Selbst die Einbände der aufwendigen Veröffentlichung fallen der offenbar bewusst geplanten, schnellen Abnutzung anheim. Überall Spuren eines alltäglichen und achtlosen Gebrauchs.

Nach diesem offensiven Auftakt wird es in den folgenden Ausstellungsräumen viel ruhiger und musealer. Es findet eine „sanftere“ Art der Publikumsbeteiligung in Form einer wandfüllenden Bespannung mit einem orangefarbenen Teppich statt. In dessen Flor darf man mit Fingern und Händen durch streichende Bewegungen zarte Spuren hinterlassen. Und die silberglänzende, interaktive Pinnwand taucht in deaktivierter Form wieder auf. Sie wird dem Kunstbetrieb veredelt erneut zugeführt. Das ursprünglich Prozesshafte verwandelt sich in einem der hinteren Ausstellungsräume, in ein nicht berührbares, in Metall gegossenes, verewigtes Kunstwerk.
Schon in frühen Jahren zog es Rudolf Stingel, den sich in Europa künstlerisch heimatlos fühlenden Südtiroler, nach New York. Dort verstand er schnell, worauf es ankam. Die richtigen Kontakte und Galeristen bekam man, wenn man seine Arbeit konzeptuell und intellektuell interessant aufstellte. Diese Lektion hatte er schnell verstanden. Sein malerisches Programm formulierte er 1989 in einem mehrsprachigen Künstlerbuch mit dem Titel „Anleitung“. Darin stellt er die einzelnen Schritte zur Herstellung einer überwiegend abstrahierend daherkommenden Stingel-Malerei vor. Sie wird von Schwarz-Weiß-Fotografien, die die einzelnen Verfahrensschritte bildhaft dokumentieren, begleitet. Unter anderem mit Hilfe von Tüll und Sprühpistole erzeugt er fast dreidimensional wirkende, strukturierte oder gemusterte Farbflächen, die vielfältige räumliche Assoziationen zulassen. Folgte man der naheliegenden Suggestion, jeder könne einen „Stingel“ nach dieser Rezeptur in einem Akt scheinbarer Kreativität erzeugen, würde man dem Künstler auf den Leim gehen. Man folgte nur minutiös seinem Konzept, ohne die zugrundliegenden, auch humorvollen Kommentierungen des Kunstmachens zu verstehen. Die nötigen, fintenreichen und kreativen Wendungen in der Ausführung seines programmatischen Ansatzes als Maler „ohne Handschrift“ führt er in geschickten Varianten in den Ausstellungsräumen der Fondation vor.

Bilder und bildhafte Objekte aus mehr als zwei Jahrzehnten seines Schaffens werden präsentiert und im Wechselspiel geradezu methodisch vorgeführt. Aus der Bauindustrie stammende, blaue Styroporplatten mit anonymisiert wirkenden, sich scharf in ihre Oberflächen eingrabenden Spuren erscheinen als Wandreliefs von kühler Ausstrahlung. Sie sind als Kunstobjekte geadelt und erinnern gleichzeitig an Reste einer fehlerhaften Massenproduktion. Der Blick wandert zu leicht sentimental anmutenden, fotorealistischen Bildern nach Fotos oder Abbildungen aus angejahrten Zeitschriften seiner Heimat oder Jugend. Das Spektrum reicht vom anrührenden, kleinen Fuchs, über Heiligenfiguren bis hin zu großen Alpenpanoramen nach Fotografien des Vaters. Natürlich dürfen auch zwei neuere Bildwerke in Schwarz-Weiß nicht fehlen, die noch einmal die frühe „Anleitung“ zur Bildherstellung zitieren und das Programmatische des Konzepts unterstreichen. Daneben bilden Tüllstrukturen und alte Tapetenmuster, mal in zarten Grau- und Rottönen, mal golden oder silbern schimmernd, unterschiedlich flächige oder sich räumlich öffnende Bildräume aus.
Auslagerung der künstlerischen Entscheidung
Stingel lagert einen Teil seiner kreativen Entscheidungen quasi aus, überlässt sie beliebigen Alterungsprozessen, dem

Konzept oder anderen Beteiligten. Seine malerischen Konstrukte enthalten keine originären, bedeutungsvollen Gesten, keine emotionalen Ausbrüche. Abstraktionen und malerische Freiheit entstehen wie nebenbei durch provozierten Zufall. Flecken, Risse und Staubspuren auf den Vorlagen werden als malerische Finessen integriert, Bildkompositionen werden durch Fußtritte und Laufspuren vervollständigt. Die Bedeutung individueller malerischer Handlungen durch den Künstler wird entmystifiziert und auf den Boden des Konzepts zurückgeholt. Gleichzeitig schafft er durch Auswahl und Methode dekorative und veredelte Oberflächen von kühler bis schwelgender Schönheit. Angesichts all der Vorführungen zu der aktuellen Rolle des Künstlers und Schöpfers eigenständiger Werke und ihrer Wirksamkeit findet man den Urheber auf einem übergroßen Selbstportrait in hingestreckter Position ermattet vor. Er ruht dort als älterer, eleganter Herr teilnahmslos und melancholisch vor sich hin sinnierend. Das Bild, natürlich gefiltert nach der Vorlage eines Fotografen inszeniert, erinnert mit seiner herbeigeführten Patina an Filmstills der 1960er Jahre. Es schafft zwischen Betrachter und dem portraitierten Künstler eine kritische Distanz, die die Auseinandersetzung mit seinem Status und unserer Rolle als ins Werk einbezogene Akteure reflektiert. Als Künstlerinstanz bleibt er unübersehbar gegenwärtig, doch die Entfremdung von seiner Rolle als Vermittler zwischen Bild und Betrachter, verbunden mit der Frage nach sinnvoller Autorenschaft, ist spürbar. Trotz aller artistischen Vorführungen und Kunststücke versinkt er, als sich zurückziehender Urheber des Ganzen, in Schwermut: Nimmt das Delegieren überhand? Erlöscht gar sein schöpferischer Impuls?

Mit seinem einleitenden, großen Teppicharrangement und einem „Feuerwerk“ des Partizipativen gelingt der Auftakt der Ausstellung inszenatorisch und konzeptionell am stärksten. Danach flaut es ab. Das Kalkül und Spiel mit entleerter, teils verblichener Schönheit in Variationen, mit einer Beigabe von Patina und Nostalgie, löst keine „malerische“ Aufbruchstimmung aus. Auch das Partizipatorische endet bereinigt und aufgewertet wiederum als Kunststück.
Gegenüber den Größen der klassischen Moderne nebenan weicht er, durchaus gelungen, ins raumfüllende Format aus. Aber der Parcours insgesamt zeigt im Spiel mit der Grenze zum Vordergründigen verführende Schönheit im Gewand elegant vorgeführter Malerei in einem ebenso eleganten Ausstellungsbau. Stingel weiß zu imponieren! Er ist gewieft genug und bedient vielerlei Erwartungen. Er reflektiert den Ausstellungsbetrieb und überführt parallel die Arbeiten ins Erhabene, Auratische und Sammlungswürdige. Er kennt die Spielregeln und hält sie ein. Stingel führt konsequent Methodiken vor, die kommentarhaft daherkommen, und doch in all ihren Reizen beeindrucken. Es sind kunstvolle Pirouetten mit hohem, riskantem Verschleißpotential. Wunderschöne Pirouetten, die wir genießen, mit der Gefahr eines Endes als Markenzeichen im malerischen „Vintage“-Kleid.
Lothar Frangenberg
Rudolf Stingel, Fondation Beyeler, Basel until October 6, 2019