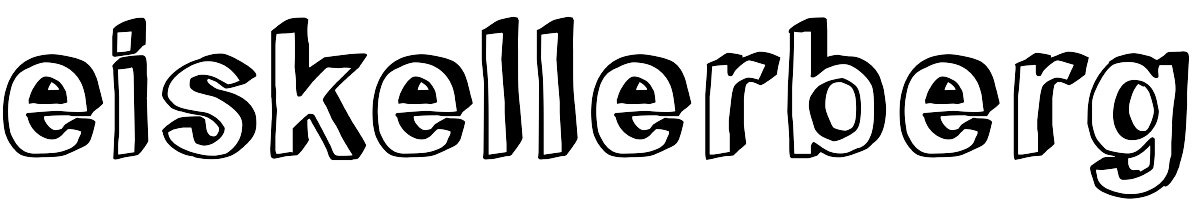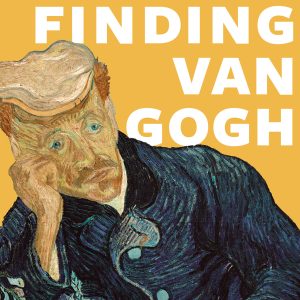eiskellerberg.tv: Im ersten Teil sprachen wir über Deinen Weg zur Kunstakademie und Dein Verhältnis zu Düsseldorf. Heute wird es um Deine Jahre als Professor für „Kunst und Öffentlichkeit“ und Prorektor der Kunstakademie Düsseldorf gehen. Wie konnte es zu der Dauerkrise kommen? Was sind die Ursachen? Was hattest Du damit zu tun?
Robert Fleck: Ja, das ist richtig. Es waren und sind zum Teil noch schwierige Jahre der Kunstakademie. Aber das Haus steht noch. Und es steht geeint da mit dem Rektorat von Donatella Fioretti. Und bleibt eine weltweit bekannte Institution. Auch aus diesem Grund war es für mich innerlich ausgeschlossen, mich nochmals irgendwo sonst zu bewerben. Wir ziehen weiterhin Studierende aus der ganzen Welt an. Im Herbst 2012, als ich die Leitung der Bundeskunsthalle verlassen hatte, hörte ich am Rande einer Ausstellungseröffnung in Bordeaux eine Museumskustodin beim Abendessen Bernard Ceysson fragen, einen ehemaligen Direktor des Centre Pompidou, wie er sich erklären könne, dass ich an der Bundeskunsthalle gekündigt hatte. Bernard Ceysson: „Eine Professur an der Kunstakademie Düsseldorf ist äquivalent zu einer Professur an Columbia, Harvard und Berkeley.“
Ich wollte nie institutionelle Karriere machen, aber wenn man in eine Institution geht und auch noch Verantwortung übernimmt, lernt man: es ist das Wichtigste, dass die Institution noch dasteht, wenn man sie verlässt – denn man verlässt sie per Definition irgendwann -, und dass sie dann auch möglichst gut dasteht. Erstes ist der Fall, und in der zweiten Hinsicht ist meiner Ansicht nach das Kapital nicht verspielt, auch wenn wir derzeit ein Defizit an international renommierten Künstlerinnen und Künstlern haben. Wenn man mitverantwortlich ist für ein solches Haus, ist der dritte Gesichtspunkt, dass niemand zu Schaden kommt unter alljenigen, die hier studieren und arbeiten. Das klingt banal, aber daran denkt man jeden Tag. Diesbezüglich muss ich mich nicht schämen, wenn ich daran denke.
Die Rektorate von Rita McBride (2013-2017) und von Karl-Heinz Petzinka (2017-2022), in denen Du zusammen mit Johannes Myssok das Prorektorat bekleidet hast, waren krisengeschüttelt. Die Konflikte drangen auch massiv an die Öffentlichkeit. Sie wühlten die Kunstakademie auf.
Das stimmt zumindest zum Teil. Wenn wir den gegenwärtigen Stand betrachten, im Sommer 2025, sieht es jedoch anders aus. Das neue Rektorat von Donatella Fioretti, in das vor zwei Jahren Tony Cragg, die Kanzlerin Johanna Boeck-Heuwinkel und ich überführen konnten, ist geeint und die Studierenden stehen hinter dem Rektorat. Der Fachbereich 2, kunstbezogene Wissenschaften, hat sich in den letzten zehn Jahren ungemein verstärkt. Das ist auch die Leistung des Dekanats von Guido Reuter und Martina Dobbe. In diesem Bereich ist über die letzten Jahre auch ein Gemeinschaftsgefühl und ein kunstwissenschaftliches Niveau entstanden, das beeindruckend ist. Nicht, dass es nicht zuvor bereits auch bestanden hätte. Mit Siegfried Gohr und Werner Spies waren ja ehemalige Direktoren des Museum Ludwig und des Centre Pompidou langjährig am Haus. Und nicht nur sie. Siegfried Gohr wollte mich dann als seinen Nachfolger für die Akademie-Galerie. Zusammen mit Frau Dr. Sondermann gelangen dann einige Ausstellungen, die nachhaltig wirken, darunter die Retrospektiven von Inge Mahn und Rissa, die beide Künstlerinnen kunsthistorisch etablierten, auch jene von Nan Hoover, Christian Megert, Jan Dibbets und Otto Piene. Sowie die Ausstellungen und Außenprojekte zu 250 Jahre Kunstakademie 2023/24.

Die angesprochenen Rektorate blieben, mit insgesamt drei Kanzlerwechseln in nur wenigen Jahren, Zeiten eines extremen internen Streits.
Das trifft zu. Ich bin der letzte, der das wollte, und hatte auch nie eine Ambition, Rektor zu werden, wie mir das viel nachgesagt wurde. Nach der für uns alle überraschenden Rücktrittsankündigung von Calle Petzinka im Juli 2022 wurde ich in Professorenrunden und auch einzeln von Professorinnen und Professoren massiv gefragt, als Rektor zu kandidieren. Es war aber klar, das wäre das Ding zu viel, nach 24 Jahren als Direktor bzw. Prorektor von Institutionen. Zudem wäre ich 70 Jahre alt am Ende dieser Rektoratsperiode in zwei Jahren. Was soll ein 70jähriger Rektor mit 19 bis 30jährigen Studierenden?
Zu den Rektoraten McBride und Petzinka ist die Vorgeschichte wichtig. Markus Lüpertz war fast drei Jahrzehnte hindurch Rektor der Kunstakademie. Und er konnte delegieren, sagte gerne: „Ich bin hier für die Atmosphäre zuständig“. Walter Jürgen Hofmann, Kunsthistoriker und Prorektor, und Peter Lynen, der Kanzler, schmissen den Laden. Lüpertz verhandelte mit der Politik. Er setzte vor allem durch, dass das Bologna-System mit Bachelor und Master für alle Kunstausbildungsstätten in NRW nicht eingeführt wurde. Ihm gelangen hochkarätige Berufungen im Kunstbereich, darunter Rosemarie Trockel, Jeff Wall, Thomas Ruff, Rita McBride, Albert Oehlen, Christopher Williams, Helmut Federle, Peter Doig, Herbert Brandl und andere. Nach außen hin war die Kunstakademie mit seinen Galeriekollegen A.R. Penck und Jörg Immendorff zu einer Malereischule „verkommen“. Für meine Generation war die Städelschule mit Kasper König das Vorbild. Aber intern war das Weltklasse. Er holte auch Tony Cragg wieder aus Berlin zurück. Dann hat Markus Lüpertz den Übergang zu seinem Nachfolger Tony Cragg ideal vorbereitet, indem er die Studierendenzahlen reduzierte, mehrere Professuren nicht nachbesetzte und somit mehrere Millionen Euro ansparte, von denen die Kunstakademie bis heute profitiert. Tony Cragg bekam auf dieser Grundlage in seinem ersten Jahr als Rektor fünf Berufungen durch, Katharina Fritsch, Katharina Grosse, Andreas Gursky – alle Weltklasse und ehemalige Studierende der Kunstakademie -, sowie aus Sondermitteln Gereon Krebber, der auch da studiert hatte, für den O-Bereich, den ersten Jahrgang, und mich als Wiederauflage der Professur „Kunst und Öffentlichkeit“ aus den 1980er Jahren. Leider blitzte Tony im Senat mit seinem zentralen Projekt ab, ein Post-Graduate-Programm nach dem Modell von „De Ateliers“ in Amsterdam in der Straßenbahn-Garage Am Steinweg.
Ein Problem war dann seine Nachfolge. Niemand wollte den Job machen. Schlussendlich schrieb ihm Rita, sie macht es. Daraufhin zwang er ihr mich als ihren Stellvertreter und Johannes Myssok als zweiten Prorektor auf. Das ging ein knappes Jahr gut, bis sie im Senat vier unabgesprochene Anträge auf einen radikalen Umbau der Kunstakademie stellte, die mit nur drei Ja-Stimmen abgelehnt wurden, wonach sie in der Sommerzeit regelwidrig sieben Professoren für Zeitprofessuren berief, die es in der Verfassung der Kunstakademie nicht gibt, und den Senat nicht mehr einberufen wollte. Wir Prorektoren ergriffen daraufhin statutengemäß unsere Rechtsaufsicht über die Rektorin. Es gelang uns in Verbindung mit einer Gruppe von Lehrenden, die Rechtsstaatlichkeit der inneren Verfassung der Kunstakademie wiederherzustellen und das Eingreifen des Ministeriums in die inneren Abläufe angesichts dieser Vorgänge zu vermeiden. Aber wir hatten einen Dauerkonflikt im Rektorat mit der Ausbildung feindlicher Lager im Haus. Der geschilderte Vorgang hat sich bis 2017 mehrfach in Abwandlungen wiederholt. Und ich muss hinzufügen, ohne hier Dienstgeheimnisse auszuplaudern – das ging ja alles durch die Presse -, dass das Ministerium stets auf unserer Seite stand. Rita schwebte wohl eine Kunsthochschule mit kurzfristig wechselnden Professuren vor, was man als Rektorin steuern kann. Das widerspricht aber der gesamten Tradition der Kunstakademie und vor allem der rechtsstaatlich verbindlichen Grundordnung. Dieser Grundsatzkonflikt schwelt bis heute.

Was war dann im Rektorat Petzinka?
Karl-Heinz Petzinka wurde 2017 ohne Gegenkandidatur als Nachfolger von Rita McBide gewählt. Er schlug Johannes Myssok und mich als Prorektoren vor. Ich erhielt im Senat gerade mehr als die Hälfte der Stimmen. Der Konflikt im Haus war offensichtlich nicht beendet, er schwelte bloß. Aber es gab eine Art Stillhalteabkommen. Ein Architekt wie Calle kennt Arbeitsteilung und Effizienz. Sein erstes Rektorat funktionierte gut. Es kam ja auch zu seiner Wiederwahl als Rektor im Juli 2021. Die Publikation in der Presse seiner Pläne für den bereits von der Landesregierung in der Finanzierung zugesagten Neubau aus seiner Hand ließ alles explodieren. Leute hielten mich auf der Straße an, ich wurde überall angesprochen: „Das darf es doch nicht geben!“
Wie konnte Calle Petzinka unterschätzen, was sein Entwurf eines (scheußlichen) Neubaus auslösen wird? Ein Vollprofi, der sich im Handumdrehen selbst ins Aus schießt?
Ich hatte auch im Detail von den Plänen erst aus der Presse erfahren. Das war ungeschickt. Aber man muss verstehen, Kunsthochschulen zu leiten ist immer in erster Linie ein Gebäudeproblem. Wir haben sehr gut geleitete und im Studium sehr wichtige Werkstätten, die aufgrund der Verdoppelung der traditionellen Techniken mit der Digitalisierung aus allen Nähten platzen. Auch aus anderen dringenden Gründen braucht die Kunstakademie mehrere tausend Quadratmeter neuer Flächen. Das suchte Calle recht mutig noch in seiner Rektoratszeit durchzuziehen. Ab diesem Zeitpunkt war dieses Rektorat aber verloren. Wir hatten Demos der Studierenden, auch einen Streik beim Rundgang, zu dem Studierende mich vorgewarnt hatten, sodass wir die Notausgänge freigeben konnten, da mit den mehreren Tausend aus dem Haus strömenden Besuchern kurz eine gefährliche Situation entstand. Das Schiff begann aus dem Ruder zu geraten.
2022/2023 wussten wir alle, die für das Haus co-verantwortlich waren, nicht mehr, ob und in welcher Form es für die Institution weitergeht. Wir hätten fast die Implosion der Kunstakademie erlebt. Die Presse war ständig hinterher. Das ist auch ihre Rolle. Die Landesregierung war sehr besorgt. An einem Zeitpunkt war ich plötzlich mit der Kanzlerin das letzte nicht zurückgetretene Mitglied des Rektorats. Da war die Überlegung: „Es ist unglaublich gefährlich, für das Ganze, wenn ich den Interimsrektor mache, aus beiden krisenhaften Rektoraten kommend. Wir brauchen eine andere Lösung.“ Tony Cragg kehrte als Interimsrektor zurück ins Haus und machte den Job grandios, mit großem Einsatz, und so hatten wir nach der Wahl von Donatella Fioretti zur Rektorin ab Anfang Juli 2023 ein funktionierendes und geeintes neues Rektorat, das bis heute besteht. Anschließend haben die Projekte 250 Jahre Kunstakademie Düsseldorf mit einer außerordentlichen Finanzierung des Ministeriums wieder gute Stimmung ins Haus gebracht. Das hatte Donatella Fioretti sofort erkannt. Ich bin also nicht besorgt.

Das Wichtigste für Dich persönlich an dieser Institution?
Die tatsächliche Freiheit der Forschung und Lehre, die es im universitären Zusammenhang kaum noch gibt durch das Bachelor-Master-System und die damit einhergehende Verschulung und Bürokratisierung an Universitäten. Ich habe beispielsweise seit 2012 600 „Exkursionen“ gemacht in Ateliers jüngerer und älterer KünstlerInnen in Düsseldorf und Umgebung und in Ausstellungen aller Art – wie organisiert man sich ein künstlerisches Leben und wie gehe ich mit Ausstellungen um, wenn ich daran teilnehme oder sie organisiere? Das sind ja die beiden großen Fragen eines künstlerischen Lebens in der Gegenwart und näheren Zukunft. Dafür muss man heute an Unis jeweils einen Antrag bei der Verwaltung stellen, in dem auch der Brandschutz und die Fluchtwege verzeichnet sind. Man hat man hier einfach vertraut, dass ich wüsste, wie ich mit Studierenden in ein Ort außerhalb der Kunstakademie gehe und wir alle in Sicherheit sind. Das zweite großartige Erlebnis war der Kontakt mit angehenden Künstlerinnen und Künstlern der jüngeren Generationen, die sich insbesondere den ungeheuren Herausforderungen der neuen digitalen Bilderwelt unserer Gegenwart und der neuen Subjektivitätsformen, die damit einhergehen, stellen – und die alle überzeugt sind, dass sie im Wesentlichen künstlerisch ihr Leben bestreiten. In Nantes, wo ich vor langer Zeit die drittgrößte Kunsthochschule in Frankreich leitete, hatten wir nur eine Handvoll Studierender, die daran glaubten, künstlerisch zu reüssiere. Auch blieben alle Auseinandersetzungen über die Ausrichtung des Hauses meiner Erinnerung nach immer fair. Und das Prorektorat gemeinsam mit Johannes Myssok, wo es über zehn Jahre trotz dieser Konfliktlage im Haus keinen Streit zwischen uns gab.
Was bleibt Dein schönstes Erlebnis an der Kunstakademie?
Das war, bevor ich überhaupt das Haus betrat. Als ich erfuhr, dass ich hierhin berufen war, rief ich spontan Kasper König an und sagte: „Kasper, ich bin jetzt Ihr Nachfolger!“ Er war zu diesem Zeitpunkt Direktor des Museum Ludwig und sagte: „Was? Da habe ich andere Namen gehört!“ Kasper König war einer der ganz großen, ersten freien Ausstellungsmacher, mit Harald Szeemann, Jean-Christophe Ammann, Pontus Hulten und Rudi Fuchs. Er hatte Hans Ulrich Obrist, mir und anderen alles beigebracht, und unversehens war ich an den Deichtorhallen Hamburg der Nachfolger von Harald Szeemann und an der Bundeskunsthalle dann derjenige von Pontus Hulten. „Kasper, ich bin jetzt Ihr Nachfolger!“ Denn er hatte ja in den 1980er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf die Professur „Kunst und Öffentlichkeit“, die ursprünglich Karl Ruhrberg zugedacht war, und organisierte in diesem Rahmen die weltweit rezipierte Großausstellung „Von hier aus“ (1984). Seine Professur war unter dem Rektorat von Markus Lüpertz nicht nachbesetzt worden. Da erst verstand er den Zusammenhang. Ich wurde an der Kunstakademie Düsseldorf sein Nachfolger! Wir haben so gelacht. „Herr Fleck, das finde ich ja gut!“ Dann hatten wir wieder engen Kontakt. In den Corona-Jahren machten wir auch per Zoom ein gemeinsames Seminar mit Nadine Oberste, der Leiterin des ZADIK in Köln, meinem Seminar und ihrer Gruppe an der Universität zu Köln. Die Videoaufzeichnung ist jetzt auf meiner Webseite. Von Kasper haben wir alle alles gelernt. Das blieb eine Inspiration, der Nachfolger von Kasper König an der Kunstakademie Düsseldorf zu sein. Wir hatten 1993 gemeinsam sein Konzept für die documenta 10 geschrieben, mit dem er zugunsten von Catherine David abblitzte. Er verstarb vor knapp einem Jahr. Die Rektorin fragte mich um einen Nachruf im Namen der Kunstakademie, den ich mit einiger Emotion schrieb. Solche Kontinuitäten sind wichtig.

Mit so viel internationaler Erfahrung und gleichzeitig so intimer Kenntnis der Zusammenhänge hier ausgestattet, wie Du ist wohl niemand. Was ist Dein Rat für die Zukunft? Wie kann die Kunstakademie wieder „Weltklasse“ werden?
Ich sehe jeden Tag, dass sie es ist. Heute war ein Abschluss eines Studierenden aus Israel, der sehr chaotisch arbeitet und einen sehr klaren, unglaublich guten, variablen Raum machte. Er erzählte, in Tel Aviv in einer Bar einem Kunden gesagt zu haben, er wolle eigentlich Künstler werden, und der Kunde sagte: „Kunstakademie Düsseldorf, Siegfried Anzinger nimmt Dich als Gaststudent auf.“ Er packte seinen Koffer, schlug sich nach Düsseldorf durch und das führte ihn auf ganz andere Wege. Als der absolute Oldie im Haus kann ich niemandem mehr Ratschläge geben, wie man mit dieser neuen Zeit umgeht. Was weiterhin ungebrochen funktioniert, und zwar in überdurchschnittlichem Ausmaß, dass die Studierenden sozusagen auf Stufe eins reingehen (was man sich vorstellt, dass die eigene Kunst sein könnte) und auf einer ganz anderen Stufe herauskommen (wo sie spüren und aufgrund ihrer Abschlussarbeiten wissen, dass das Kunstmachen der Lebensmittelpunkt bleibt, auf einem von ihnen ungeahnten Niveau, ob international, regional oder in welchem Radius, den sie persönlich in ihrer Lebensplanung organisieren können). Das macht eine Kunstakademie mit weltweiter Wirkung aus. Unsere nichteuropäischen Absolventinnen und Absolventen erhalten in ihren Heimatländern oft direkt Professuren an Kunstakademien. Was wiederum den Mythos Kunstakademie ausmacht und am Leben erhält. Weil sie sagen ihren künftigen Studierenden: „Bewerben Sie sich noch mal in Düsseldorf.“ Das funktioniert immer noch.
Vielen Dank für das Gespräch.
Lesen Sie weiter
Robert Fleck nimmt Abschied und wird… TEIL I
Spuren des Protests an der Kunstakademie Düsseldorf