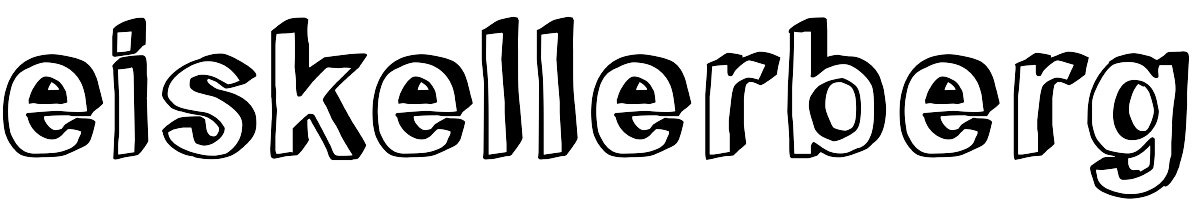Eigentlich wunderbar. Aber was will das schon besagen? Eigentlich provoziert ein böses Erwachen: Aber. Alles wunderbar hier in der Ausstellung „Fabelfakt“ von Pia Fries. Hohe Hallen, strahlend weiße Wände, gleichmäßig grell ausgeleuchtet. Zur Besichtigung freigegeben.
Wir betreten das Werk einer gestandenen Malerin. Eine sich über Jahrzehnte kontinuierlich entwickelnde Malerei, ein in sich geschlossenes Werk, ordentlich beschriftet, in sieben Räume gegliedert, mit sonderlichen Titeln versehen – parsen und module, merian, der name der farbe, weisswirt und maserzug, seewärts, corpus transludi, aussicht und passage. Der Parcour kann beginnen.
Weiter hinten in einem der sieben Räume finden sich zwei Sitzbänke. Darauf ließe sich verschnaufen. Im Sitzen die Wucht der Bilder aushalten oder tiefer aufnehmen. Oder im Katalog blättern, der da ausliegt. In der Mitte „Marsyas“, ein Text von Thomas Hettche über Literatur „Unsere leeren Herzen“. Der beginnt mit einer kolossalen Frage: „Was entziehst Du mir selber mich?“
Marsyas also. Der Satyr, dem Apollo die nackte Haut vom Leib riß. Hettche: „Idem der Marsyas vorführt, düpiert, fesselt, häutet, die Eingeweide herausreißt und ihn antwortlos zurückläßt, tut Apoll mit diesem dämonischen Halbgott das, was wir mit der Kunst tun, die wir zu begreifen suchen“. Wir sind gewarnt. Die blutige Geschichte erzähle von den „Gefährdungen des Künstlers in der Öffentlichkeit und von der Grausamkeit der Kritik“. Auch davon, daß es eigentlich immer um Wahrheit ging. Um etwas, das immer schon feststand, sich aber verbarg. Um etwas wie ein Rätsel, das nach Lösung verlangt. Daher die Häutung. Ein Gewaltakt, eine Todesqual. “Gerade der Künstler also, der sich in unserer Lesart des Mythos als so ungeeignet für den Wettstreit erwies, benötigt die agonale Auseinandersetzung, damit eine Wahrheit freigesetzt werden kann, die er anders auszusprechen nicht vermöchte.“
Damit hatten wir nicht gerechnet. Darunter ist es nicht zu haben, Fabelfakt, die Malerei der Pia Fries. Was noch gesagt werden kann über diese rundrum gelungene Ausstellung im Kunstpalast (die ja lange geplant wurde, als der Palast noch Museum hieß), müßte diese agonale Auseinandersetzung suchen mit der Künstlerin wie mit ihrer Kunst. Streitlustig, wahrheitsdurstig.
Vexier. Vom Weiß her sehen
Was wir sehen, wahrnehmen ist eine Hingabe an die Farbe, ein sich Lösen und Schwelgen, ein Ausweiden und Ausschweifen bei hoher malerischer Fertigkeit. Alle erdenklichen malerischen und druckgrafischen Techniken etwa von Max Ernst über Jackson Pollock und Gerhard Richter (ihrem Lehrer an der Düsseldorfer Kunstakademie 1980 bis 1986) kommen zum Einsatz. Erst diese Pole, Antipoden – das Freilassen der Farbe und die hohe malerische Kultur – lassen eine Malerei entstehen, die uns das Äußerste bietet und abverlangt: Fassungslosigkeit. Ein glänzender Sieg der Sinne über den Sinn.
So auch die Fläche selbst, auf denen sich die Farbe ereignet, sich einnistet und darauf wuchert, aufbauscht und auftürmt und immer wieder gegen das Weiß abgesetzt wird. Ach die ungezählten Weißstufen! – „Orte der Verschneiungen und der wasserhaltigen Lüfte, der Montangewalten und ihrer Lichtbrecher, der Barockgespenster, der Halos“ (so Hans Brändli im Katalog). Gewiss, die Leerstellen sind wie der Widerspruch zu den Farbkaskaden. Jedes Bild erscheint jetzt als eine gültige Komposition und der Vergleich mit Musik legt es nahe, die Akkorde und Cluster der Farben mit der Stille der (weißen) Pausen zu sehen, zu hören. Vielleicht ein zweiter Durchgang durch diese grandiose, fordernde Ausstellung gefällig? – Die Bilder als Vexier. Vom Weiß her sehn, auf dem sich die rohe Farbe nur ausgelassen verschwendet. Oder sich häutet.
bis 16. Juni, Katalog (Verlag der Buchhandlung Wather König) lesenswert