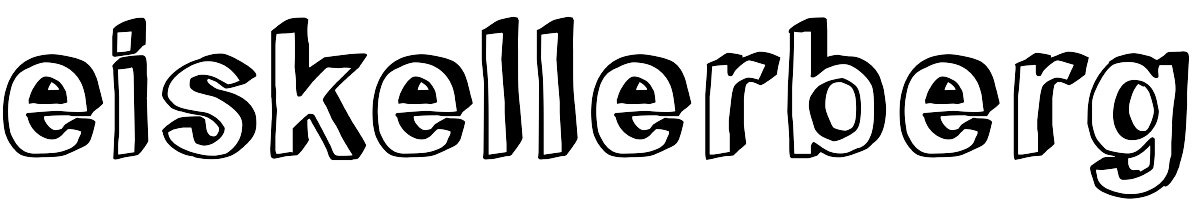Wendelin Bottländer ist viel in Bewegung. Tags, nachts, frühmorgends. Mit dem Taxi, mit dem Fahrrad, mit und ohne Kamera. Zwanzig Jahre fuhr er Taxi kreuz und quer durch Düsseldorf. Bei Otto Steinert in Essen hat er auf Fotojournalismus gelernt, dann bei Bernd Becher und noch später bei Nam June Paik an der Kunstakademie Düsseldorf. Seine Unentwegtheit hat er im DFI-Projektraum, gegenüber der Kunstakademie jüngst in ein „Langzeitprojekt“ übersetzt.
Über 17 Jahre lang hat er aus seinem Küchenfenster heraus Veränderungen im Hinterhof in Bilk dokumentiert. Aus tausenden Fotos hat er 458 zu einer Bildstrecke zusammengefasst und „laufen lassen“, eine Diaprojektion, ein Sozial-Panorama über die allmähliche Veränderung unserer Stadt aus der Küchenfensterperspektive.
Auch der DFI-Projektraum verschwindet. Im Februar ist schon wieder Schluß. Imi Knoebel will dort zum Ende noch seine Fotografien zeigen.
eiskellerberg.tv: Welche Rolle spielt Taxifahren?
Wendelin Bottländer: Auf jeden Fall eine große Rolle. Die optischen Ereignisse bei der Taxifahrerei sind überwältigend. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe das ja ab 1998 gemacht. Zwischendurch habe ich auch immer mal wieder ein paar Jahre ausgesetzt. Aber Taxifahrer ist dann auch ’ne Berufung, die man so hat. Da weiß man: Hier hast du mit der Gesellschaft zu tun. Du verdienst Geld und du gewinnst einen Einblick. Und zwar von allen Seiten. Das kann man selber steuern. Taxi fahren ist irgendwie auch der Wilde Westen. Jeder versucht, Geld zu verdienen und du musst da sein, wo du eben gefragt bist. Und ab einer gewissen Uhrzeit, wenn am Flughafen nichts mehr zu tun ist fahren sie dann alle in die Altstadt. Wenn sie am Flughafen um 23 Uhr merken, ich bin zu spät, oder noch schlimmer, um 24 Uhr sich ihr zu spätes Auffahren erst zeigt und sie dann wieder leer wegfahren müssen. Dann fuhren sie alle, manchmal fünfzig, achtzig Wagen vom Flughafen hier her, alle Heinrich-Heine-Allee und stauten sich am Ratinger Tor. 2014 habe ich das vom Parkhaus an der Ecke gegenüber herab gefilmt, ein gnadenloser Stau von Taxis. Der sichtbare Kampf ums Geld.

Man hat z.B. Einblick über die Verrückten nachts in der Altstadt. Je länger die Nacht dauert, neunzehn, zwanzig Uhr, Mitternacht, drei Uhr, um so absurder werden die Erlebnisse. Die Altstadt in Düsseldorf ist in Deutschland, jetzt mal abgesehen von München, Oktoberfest, das absolute Highlight für sich Betrinken. Ratinger Straße sind mehr so die jüngeren Leute, nie Problemkunden. Diese steigen hauptsächlich an der Heinrich-Heine-Allee ein, weswegen sich dort auch die abgebrühtesten Taxifahrer-Kollegen versammeln. Die am meisten abkönnen, die ein dickes Fell haben. Je nach Laune konnte man es als Fahrer steuern, ob man in diesen Herausforderungskurs ging.
Auf der Grenze der Machbarkeit
Es gab so viele faszinierende Begegnungen mit Fahrgästen, ich nenn mal so ein Beispiel einer längeren Fahrt auf der Grenze der Machbarkeit. Ich war am Burgplatz Position 4, stand in der Nähe meines Taxis mit offener Fahrertür und aß eine Pizza. Es war ein Uhr morgens und nicht allzu viel zu tun. Ich redete mit den Kollegen und auf einmal sah ich, dass eine Person in meinem Taxi saß. Und zwar auf dem Fahrersitz am Steuer. Ich kam hinzu und fragte ihn, ‚hallo, was machen Sie da?‘ Bald merkte ich, dass er zwar sternhagelvoll aber ok war und als er offenbar nicht verstand, befragte ich ihn zur Sicherheit auf Englisch. Die Sprache passte und so erklärte sich auch das seitenverkehrte Einsteigen. In UK steigt man links ein, da der Fahrer rechts sitzt. Er war also ein Fahrgast. Zuerst versuchte ich ihm klarzumachen, dass er bitte zu Taxi Nr. 1 gehen möge. Er wollte aber nicht, sondern war inzwischen geschickt rechts rüber gerobbt. Ich fragte die Kollegen, ob ich ihn mitnehmen könne und sie waren dankbar, vor ihm verschont zu bleiben. Nun begann eine minutenlange Befragung, wohin er denn wolle. Es war nicht aus ihm herauszukriegen, er gab sich zwar Mühe, aber konnte weder Stadt noch Straße nennen, jedenfalls keines seiner alkoholisierten Worte passte zu irgendeinem Begriff, den ich umsetzen konnte. Manche Kunden wollen auch einfach nur in eine andere Kneipe in der Altstadt. Ob er in ein Hotel wolle? No! Ob er home wolle? Yess! Ob das in Germany sei? Yess, sure! Irgendwann konkretisierte sich ein viersilbiges Wort, das sich als Avenwedde herausstellte. Hatte ich noch nie gehört. A part of Gütersloh. Passte, dort ist britisches Militär. You really want to go home now with the Taxi, it costs about 400!
Er gab an, er habe jetzt kein Geld, aber zuhause eine Bankkarte. Also Risiko, denn falls er nicht zahlt und auf diese Weise standardmäßig reist, kann man auch mal komplett leer ausgehen. Und dafür stundenlanger Stress? Aber meistens kann man die Kunden an der Art ihrer Stimme und ihres Ausdrucks einschätzen; ich hielt ihn für ehrlich. Zusätzlich gibt es bei Soldaten, die aus Düsseldorf mit dem Taxi nachts in die Kaserne zurückkehren, die Regel, dass der Kasernenwachmann ein Bargeldbudget für solche Fälle hat, mit dem die Fahrt beglichen wird. Zudem hatte ich in dieser Schicht noch keine nennenswerten Umsätze.
Also: auf gings. Aber sobald wir den Halteplatz verlassen hatten, ging das Theater los. Where are the others? Er war sehr erschrocken, dass die fünf Anderen nicht da waren. Ich hielt an und erklärte ihm, dass er alleine gekommen sei. Und sollte es andere geben, würde ich gerne auf die warten. Klar, denn dann geht’s auch mit dem Fahrpreis. Ich hielt an und schaute umher. Keine Engländergruppe in Sicht. Er versuchte es telefonisch, keine Chance. Irgendwann dämmerte es ihm: ahh, the others have gone to a bar, a night club, to the girls! I have split for tonight, I leave, I don’t wanna share them. No hookers. I gonne go home. To me wife! I love ma wife! Lets go!!
So starteten wir nun und fuhren gen Osten, ohne Navi, aber da Gütersloh an der A2 liegt, kein Problem. Ich war gutgelaunt. Viel konnte er nicht sprechen, aber er ruhte in sich. Bei sehr betrunkenen Fahrgästen gilt es, zwei Dinge dringend zu berücksichtigen: Punkt 1. Übelkeit muss durch höchst sensible und ruckelfreie Fahrweise verhindert werden. Dies ist eine unverzichtbare Sorgfaltspflicht. Infolgedessen wird ein Kotzen des Fahrgastes schon mal erheblich unwahrscheinlicher. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Dosis der Intoxikation evtl. zu erheblich war. Daher sollte man bereits die leisesten Anzeichen wahrnehmen, ausrollen lassen und ihm die Chance geben, sich draußen zu erleichtern. Diese Warnzeichen zeigten sich aber nicht und ich wurde zu sorglos. Denn kaum hatten wir die Ausfahrt Bergkamen auf der A2 ohne Übelkeit passiert, zeigte sich, dass ich Punkt 2 des Pflichtverhaltens eines Taxifahrers vergessen hatte. Toilettengang muss auch kurzfristig möglich sein, da stets teils erhebliche Mengen Bier konsumiert werden. Naiverweise hatte ich eine ganze Stunde lang vergessen, ihn danach zu fragen.
Und natürlich kam das Thema genau in dem Moment auf, als wir die für längere Zeit letzte Abfahrt der vielbefahrenen Autobahn passiert hatten. Anhalten auf dem Standstreifen mit einem Betrunkenen sehr gefährlich. Ich fragte, ob er noch ein paar Minuten aushalten könne und er bejahte, schon leicht schmerzverzerrt. Wie es immer so ist: Aus dem nichts fuhren wir in die Umleitung einer Nachtbaustelle, es gab keine Standstreifen mehr und plötzlich erschienen hunderte Autos und Lkws mit Tempo 10-20 vor uns, die die Endzone eines riesigen zähflüssigen Pulks vor uns bildeten. Anhalten total ausgeschlossen. Durchhalten angesagt, aber mein Fahrgast litt inzwischen massiv. Man leitete uns ins Kamener Kreuz über dubiose neuartige Wege, da die Durchgangsspur gesperrt war. Wir landeten weiter zweispurig auf einer Tangente und befanden uns auf der linken Spur, als der Verkehr ganz zum Erliegen kam. Ich stieg kurz aus, machte mir ein Bild von der Lage und entschied, dass wir garantiert noch ein Weilchen stehen würden. Ich gab dem Engländer die sofortige Freigabe und er raste durch die rechts stehenden LKWs, über die Leitplanke und verschwand unten im Dunkeln, um zu pissen. Aber: erheblich früher als vorausberechnet, löste sich hundert Meter vor uns der Stau langsam auf. Kein selten so rückersehnter Engländer hinter der Leitplanke in Sicht. Der rechte Fahrstreifen mit den LKWs nahm Fahrt auf. Ich blieb einfach stehen, obwohl meine Vordermänner alle bereits losfuhren. Hinter mir Gehupe. Inzwischen hatte die rechte Spur bereits Tempo 50, ich stand dort weiterhin, wurde allerdings langsam panisch, denn wie sollte der Mann in seinem Zustand angesichts des Tempos des Fahrstreifens jemals nochmal zu mir rüberfinden? Panik! Ich schaute Richtung Leitplanken und während die LKW-Kolonne immer schneller wurde, tauchte plötzlich sein Schatten auf. Die LKWs verdeckten ihn immer wieder, aber wie im Stummfilm sah ich seine Bewegungen im Zeitraffer, wenn Lücken entstanden. Mit der unfehlbaren Immunität eines Todgeweihten überquerte er die Bahn, ein LKW bremste für ihn und drin war er wieder im Taxi. Im Anfahren fiel er mir weinend um den Hals und beteuerte, dass ich ein unglaublich guter Mensch sei, der ihn nicht im Stich gelassen hätte, da er ansonsten von allen verlassen in der Einsamkeit untergegangen wäre. Die Stimmung war nun bestens, auch da er befreit von der Qual war. Ich verzichtete darauf, ihm zu gestehen, dass auch ich glücklich war, ihn nicht verloren zu haben. In jeder Hinsicht. Wir fuhren dann wegen Umleitungen und Staus noch Stunden weiter, hängten uns ab Bönen an einen viel zu schnellen SUV mit GT-Kennzeichen, durchrasten immer seinen meist nur noch ahnbaren Rücklichtern folgend, kilometerlange unbekannte Wälder und erreichten Avenwedde im Morgengrauen. Entgegen meiner Annahme, er sei in einer Kaserne stationiert, leitete er mich in eine noble Gegend und er war inzwischen wieder halbwegs fit. Offenbar war er ein höherer Rang, der in seiner eigenen Villa wohnte. Dort angekommen waren 440 € zu zahlen. Leider hatte er keinen Hausschlüssel. Die Klingel war zu leise und nichts regte sich im Hause. Er begann, gegen Fenster zu klopfen, zu hämmern, keine Reaktion. Er sagte, manchmal schlafe seine Frau in einem anderen Zimmer. Er warf Steinchen auf die schrägen Fenster im Obergeschoß. Irgendwann warf auch ich Steinchen auf die Fenster. Immer mehr, immer größer. Aber nicht zu groß. Wir rüttelten an allem, was Lärm machte. Und tatsächlich, irgendwann öffnete sich ein Kippfenster und ein verschlafenes Kind rief ‚Daddy?‘ Drinnen fand sich schnell seine Bankkarte. Der Automat im Ortskern warf bei dieser Karte maximal Hundert Euro aus; Sicherheitsgründe gegen militärisches Geld Verprassen. Da es aber ein typisch englisches System war, konnte er das mehrfach wiederholen, so dass ich korrekt bezahlt wurde. In Freundschaft verabschiedete ich den Mann, der als einziger seiner Feiertruppe seiner Frau treu geblieben war.
Fotos von Kunden habe ich aber nie gemacht, das habe ich getrennt. Ich habe zwar auf der Fahrt oft Bilder gesehen, die ich gerne fotografiert hätte. Sehr oft. Ja, wie im Vorbeifahren mit dem Fahrrad eben. Da ist es plötzlich, denkt man, wenn man doch in der Nacht Betonschicht fährt und diese scharfe Beobachtung hat und das literarische Interesse daran. Dann funktionieren die Bilder ja ganz anders als Fotograf nochmal. Dann sitzt man stundenlang in dieser Box Auto und dann denkt man doch, ja, da gibt es ganze Serien von Fotos. Könnte es geben. Aber das habe ich immer auseinandergehalten. Insgesamt ist natürlich nur ein Bruchteil der Kunden so angetrunken wie der Kunde nach Avenwedde. Daher entstehen während der Taxifahrt oft ernste oder persönliche Gespräche. Die natürlich beiderseits auch ins Zeitfenster passen müssen.
Eins meiner ungeschickten Erlebnisse in dieser Hinsicht begab sich auf einer Tour von Oberkassel zum Flughafen. Das ist 20 Jahre her. An dem Tag wollte ich Umsatz machen. Mit dem Fahrgast hatte ich ein tiefgehendes Gespräch über Freundschaft. Ich hatte ihn zur Abflugebene gefahren, die Fahrt war beendet, wir hatten bereits abgerechnet aber waren noch mitten in diesem Gespräch in einem anderen Universum. Kommt ein fremder Mann, klopft an die Scheibe und fragt: Sind sie frei? Da ein Soforteinsteiger am Flughafen so selten wie eine Fata Morgana daherkommt, musste ich mich sofort entscheiden. Und antwortete dem neuen Fahrgast, klar, mach ich. Und sagte zu meinem Fahrgast, oh tut mir leid, ich muss jetzt weiterarbeiten, Sie verstehen. Das war ein echter Zwiespalt. Wirkt wie ein Rauswurf. Im Sinne, Sie haben bezahlt, Ihre Sprechzeit ist zu Ende. Unfair. Das ist noch ein zweites Mal passiert. Ein Afrikaner bestellte ein Taxi in Gerresheim und wollte zur Bilkerstraße. Das ergab sich aber erst während der Fahrt, weil sein Fahrtziel war Staufenplatz, er wollte nur zur Straßenbahn. Ich hatte an dem Tag aber privat was in der Stadt zu tun. Da habe ich zu ihm gesagt komm, gib mir den Zehner zum Staufenplatz, den Rest nehme ich dich so mit. Er freute sich und wir unterhielten uns. Unterwegs standen plötzlich an einer Straßenbahnhaltestelle Winkefiguren, ein älteres Ehepaar. Ich sag zum Afrikaner, sorry, nimm dann lieber doch die Straßenbahn. Und ich übernahm die zahlenden Kunden zu ihrem Wunschziel. Auch ungeschickt, denn wenn es auch formal kein Betrug ist, zeigt es doch schlechten Stil. Im Sinne, wir reden zwar miteinander, aber im Zweifel bist Du doch nur Verfügungsmasse. Ich habe daraus gelernt und so einiges übers Leben verstanden.
Der Moment, wo etwas passiert, ist entscheidend. Oder Folkwang bei Otto Steinert
Ich habe Steinert noch ein Jahr lang kennengelernt. Andreas Gursky und ich hatten bei ihm das Semester 1977/78. Steinert starb im März 1978. In dem Jahr hatten wir ihn im Fach Bildjournalismus und er war präsent, er war präzise, er hatte eine Aura. Und er war jemand, der die situative Fotografie stützte.
Das heißt, er lehrte nicht nur kalkuliert zu fotografieren, wie sein Buch „Subjektive Fotografie“ nahelegt. Das täuscht ein bisschen. Der Moment, wo etwas passiert, ist entscheidend. Das Fluidum, nicht nur der Steinert, das ganze Fluidum der Journalisten hat einen natürlich damals geprägt. Der Moment, der die Symbolkraft hat. Man versucht dann auch wirklich voll da zu sein. Damals war jedes Foto einzeln und vielleicht auch einzig.
Ich habe mal eine Weile Sport fotografiert. Wenn du das Tor wirklich im richtigen Moment haben willst, ist es eher günstiger, wenn du nur einmal draufdrückst, damit der Ball an der richtigen Stelle auf dem Bild ist. Die Motorkamera machte 6 Bilder/sec., aber dann hat man evtl. 6 falsche Momente. Man hatte Respekt vor dem einzelnen Bild. Die Filme kosteten ja was und man musste präsent sein und wollte auch genau entscheiden, wann ist der Höhepunkt? Jetzt abdrücken. Das war sicherlich die Steinert Logik und Steinert war natürlich Drama.
Er liebte die Bildästhetik eines Herbert List, diese Schwarz-Weiß Dramatik, gab es ja auch damals im Kino.
Alle müssen das Spiel verstehen und lesen. Die Fussballschule
Aus der Steinert-Schule kamen diverse sehr gute Fotografen und Fotografinnen wie die Visum-Gruppe, Michael Wolf, Anne Koch, Hartmut Neubauer, Rautert, Izikowitz. Der ist damals nach Portugal gefahren, um live die Revolution zu fotografieren. Die Dramen in Schwarz-Weiß, Kodak Tri-X, vierundzwanziger Nikon. Das war so ein Ding, da passte alles zusammen. Weltgeschichte fotografieren. Einer von denen hat einen Afrikaner, der bei der Machtübergabe den Kolonialherren das Zepter klaute, genau in dem Moment fotografiert. Das war natürlich die Krönung, wo man dachte: „Aha, der Fotograf ist der Magier, der wie gottgleich weiß, was passiert und das es genau in dem Moment passiert. Ja, das muss ein Zauberer sein, war dabei aber natürlich ein kluger Spekulant. Der Fußball ist ein interessantes Prozessmodell für Spekulation, in dem menschliche Verhaltensabläufe symbolhaft ständig durchexerziert werden. Dort passiert das Analysieren und Vorhersehen von möglichen baldigen Ereignissen immerzu, aber in überschaubaren Rahmenbedingungen. Wo wird der Ball gleich sein? Meine Gegenspieler denken, er kommt dorthin, aber ich spekuliere mal, dass der ganz woanders hinkommt. Dann kriegt man den Ball dadurch vor die Füße, dass man sich in den Raum bewegt, wo die Anderen eben nicht sind. In der Sportfotografie ist es ja auch so, die Fotografen hinter dem Tor sind Konkurrenten und alle glauben, dass sie die Experten sind, die richtige Brennweite haben, den Ablauf vorhersehen können und so weiter. Alle müssen das Spiel verstehen und lesen, weil die Schärfezone manchmal blitzschnell wechselt und du bist sehr nah dran. Du musst das können.
Pokal-Halbfinale in Köln 1983. Ich bin FC Fan, also hoffte mit. Ich war so begeistert über eine entscheidende Konteraktion von Littbarski, dass ich den Torjubel der Spieler vom Spielfeld aus fotografiert habe. Zurecht total verboten. Sünde. Die anderen Fotografen stehen hinter dem Tor und du stehst im Weg. Ich habe einen solchen Anschiss gekriegt. Ich hoffe, die anderen haben trotzdem ihr Bild gehabt. Ich hatte mein gutes Foto. Die Jubeltraube der Kölner. Ich stand für drei Kollegen ganz klar im Bild. Und die brauchten keinen Idioten mit einer Kamera da im Vordergrund.
Unter ganz anderen Vorzeichen kürzlich das Aufeinandertreffen mit einem Kollegen, der ein Video von einer Museumseröffnung machte. Dort hatte ich einen Job, für das Museum zu fotografieren und der Kollege hat mich nach einer Eröffnung massiv im Treppenhaus beschimpft. ‚Wie konntest du es wagen, während der Laudatio im Bild rumzulaufen?‘ Ich war kurz auf der Bühne gewesen, um aus der Nähe von der Schlüsselübergabe ein Foto zu machen. Völlig okay. Aber der Kameramann schimpfte: ‚Du hast meine ganze Sequenz von 60 Minuten zerstört.‘ Er hatte den kompletten Ablauf für sich als sakralen Vorgang eingeordnet, bei dem Fotografen nicht aufzutauchen haben. Warum? Fotografen betonen doch durch ihr Bildermachen in der Szene die Wichtigkeit des Ereignisses, was für eine Dokumentation aus der Totalen dazugehört.
Zurück zur Folkwangzeit. Besonders hat mich eine Foto-Arbeit beeindruckt, die Hartmut Neubauer, auch ein Steinert-Schüler, über Eintracht Braunschweig gemacht hat. Schwarz-Weiß-Fotografie, die scheinbar eine Reportage zu sein schien. In Wirklichkeit war es beste Dokumentarfotografie. Er hatte einen Blick für die ganz einfachen aber ikonischen Momente der beginnenden Ära des deutschen Profifußballs, für die üblichen Medien nicht interessant, aber Klaus Honnef und Schürmann erkannten die Qualität und so wurde die Serie in der großartigen Ausstellung ‚Aspekte deutscher Dokumentarfotografie‘ 1979 in Bonn gezeigt.
Die Industrie an sich hat mich immer sehr interessiert
Die nächste Inspiration war Becher. Die Bechers hatten ein Werk, das war umwälzend. Das Thema war ja eine grundsätzliche Erkenntnis der Ästhetik des menschlichen Wirkens im Industriezeitalter. Eine Art neuere Archäologie. Was ich damals erst begann zu verstehen.
Das Faszinierende war, dass sie in einer unglaublichen Konsequenz auf optische Phänomene aufmerksam machten, die der menschlichen Entwicklungskultur sozusagen das Antlitz zeigte. Das Antlitz von Maschinen, von Systemen. Das Gesicht, was und wie eben diese Welt geschaffen ist. Ich hatte eine Spielzeug-Eisenbahn gehabt. Ich fand es total faszinierend, in diese Welt reinzublicken, sich seine eigene Welt zu erschließen. Nichts anderes macht ein Fotograf, der etwas abfotografiert.
Ich mache Fotografien, die erstmal Dokumentarfotografie sind. Und das ragt in die Abstraktion hinein, indem ich das oder was auch immer da ist als Skulptur betrachte, dann bin ich im Bereich der Kunst. Da beginnt die Transformation.
Die Industrie an sich hat mich immer sehr interessiert. Und zur Industrie gehört auch Häuser und Straßen bauen, Städte bauen. Das ist natürlich etwas, was, wenn man jetzt sagen wir mal 5000 Jahre zurückdenkt, was es erst relativ kurz gibt in der Menschheitsgeschichte. Und wir werden da reingeworfen. Dann heißt es in der Familie: Ja, der Papa arbeitet bei Bayer, da hinter dem Bayerkreuz im Werk.
Hausgroße Kunst dieses Kreuz. Man weiß zwar, was das alles für Funktionen hat, aber als Bild, als Gegenüber wirkt es auch emotional. Ich trete in Kontakt, in einen Dialog zu dieser anonymen Skulptur, die für mich gar nicht so anonym ist, sondern die hat ja auch irgendwie eine Geschichte hat. Ein Stück Heimat ist. Heimat und Erinnerung. Gerade diese Typologien, die die Bechers damals gemacht haben, diese Vergleichbarkeit und die Unterschiedlichkeit, das Individuelle in dem scheinbar Ähnlichen. Das ist dann wie Autoquartett, nur eben auf eine viel differenziertere und umfassendere Weise.
Bei Becher. Er wollte die Leute dahin bringen, dass sie verstehen, das man für jedes Objekt ein Auge haben muss
Ich brachte ihm ein paar Parkplatzfotos. Die sehr radikal fotografiert waren, mit 60% Himmel drauf. Das war ihm zu viel Himmel. Diese Parkplatzfotos sind Jahrzehnte später entdeckt worden von dem einen oder anderen, der sie dann ausgestellt hat. Und letztens rief ein Buchverlag an und wollte genau eins dieser Bilder drucken und sie haben erkannt, dass das interessant ist. Ich fand das ja auch gut. Aber der Becher meinte: „Komm, fotografier mal einen Stuhl, dann reden wir über Perspektive. Eine super Aufgabe. Ich habe aber gedacht: „Komm, das hast du nicht nötig, so als 23-Jähriger. Da denkst du: „Jetzt lass mich mit dem langweiligen Zeug in Ruhe. War aber gar nicht langweilig. Das wäre sogar notwendig gewesen, mich mal ein bisschen trainieren zu lassen und mal eine Reflexion über die Perspektive bei Stuhlfotografie. Weil Stuhl ist interessant, der hat vier Beine und eine Lehne. Wie fotografiere ich den? Wie beleuchte ich den? Welche Perspektive ist die richtige? So Standardfragen. Der Becher wollte natürlich seine Leute darauf hinweisen. Er wollte die gar nicht gleichschalten. Becher war viel zu souverän. Das war ein Weltmann. Auf jeden Fall, der Punkt war, er wollte die Leute dahin bringen, dass sie verstehen, das man für jedes Objekt ein Auge haben muss. Hilla hat das mal ganz gut beschrieben mit: „Die Skulptur gibt dir etwas, aber fordert vom Fotografen das Recht auf ihre eigene Perspektive“. Die Hilla machte aus den Skulpturen Wesen, sozusagen ein Gegenüber, dem Menschen gleichgestellt. Kommunikationspartner. Das fand ich sehr passend und schön.
Ich verließ angesichts der Stuhlaufgabe die Klasse und wechselte zu Nam June Paik. Ich hatte zu Bernd Becher nach dem Ausstieg ein paar Jahre lang gar keinen Kontakt mehr. Als ich ihn 1989 wiedertraf, fragte er mich: „Mensch, Wendelin, was machst du? Ich sagte: „Ich bin Fedex-Fahrer geworden“. Er sagte: „Wo arbeitest du denn?“ Ich sagte: „Zum Beispiel in Sprockhövel, da sagte er: „Sprockhövel? Da haben wir unsere ersten Bergbau-Werke fotografiert, Kohleförderanlagen im Tagebau.“ Und er fing an, davon zu erzählen. Er hatte diese ganze Logistik in Geografie, in Industriegeschichte, wo was ist, hatte er komplett drauf. Ich hatte mich damals noch gar nicht so ausführlich mit dem Bechers-Werk beschäftigt. Hatte auch gar nicht die tiefe Verbindung dazu. Ich wusste, da ist was, was hochinteressant ist, aber ich mach jetzt erst mal meine Welt und die hat ihre eigene Dynamik. Deswegen bin ich auch nach zwei Jahren vom Becher weggegangen, denn ich hatte meine eigenen Vorstellungen.
Nam June Paik war für mich wie so ein Buddha
Paik hatte den Video-Buddha gemacht. Für mich war das ein offener, phantasievoller Weltmann, der auch eine Ruhe ausstrahlte. Vielleicht brauchte ich den als Gegenpol. Sein Satz ‚when too perfect, Gott böse‘ beeindruckt mich bis heute. Hab ihn vor meiner Akademiezeit mal zufällig am Hauptbahnhof getroffen und war beeindruckt, wie locker er war. Aber es war keine gute Idee, zu ihm in seine Klasse zu gehen. Ich habe keine Videos gemacht und in der Klasse passten die Interessen oder Ideen nicht mit meinen zusammen. Das war nicht meine Welt.
Daher habe ich autodidaktisch weitergemacht. Wie eigentlich schon immer. Ich hatte so viele Einflüsse, nicht nur die drei Pole, Steinert, Becher, Paik. Beeindruckend war auch William Eggleston, den gab es für mich seit 1978. Es gab viele Leute aus den Fotozeitschriften, die damals ja noch eine wichtige Rolle spielten. Da guckte man rein und wusste, es gab ja auch Anderes. Mit Achtzehn war ich in einer Formentwicklungsphase und noch unentwickelt, die Inhalte zu bewerten. Ich wusste noch kaum, dass die Erkenntnis, das Drama, die Erlebnisse, die gesamten Identitätsfragen in Bildern entscheidend sind und nicht nur die gute formale Aufteilung.
Meine Mappe, mit der ich mich bei Folkwang beworben habe, ist voller 50 mal 70cm Hartmaterial, schön gemachte Mappe. Technisch top Qualität für die Ewigkeit. Sauber geprintet, aufgezogen, alles ganz toll, aber zwei Drittel der Inhalte sind Mittelmaß. Doch das andere Drittel ist interessant. Z.B. ein 6×6 Foto in einer verfallenen Arbeitersiedlung in Bochum. Einfach nur ein Bild mit zwei Häusern, beide angeschnitten, aber spannend und sauber komponiert. Form und Inhalt auf derselben Höhe. Ich habe mich oft in meinem Leben mit ganz unterschiedlichen Themen befasst. Ich habe so viele unterschiedliche Erlebnisse und Themen versucht unter einer persönlichen Sichtweise darzustellen. Das ist mein Stil. Ich spanne einen sehr weiten Bogen, der Aspekte meines Stils in jedem Bild enthält.
Typische Bottländer
Da ist ein Bild, das einer meiner typischen Arbeitsweisen entsprang. 1996, wir waren in Mecklenburg. Ich hatte extra mal keine Kamera auf die Reise mitgenommen, weil ich schon auch ein ziemlicher Fotomaniak sein kann. Aber in Schwerin bin ich schwach geworden und habe mir auf dem Marktplatz in einem Fotogeschäft für 10 Mark eine Kamera mit Film gekauft. Ich fahr mit meiner Freundin auf dem Fahrrad an der Seenplatte entlang. Und dann, mit der Kamera in der Tasche habe ich im Vorbeifahren plötzlich was gesehen. Einen Vorgarten. Das war so ein Moment. „Halt mal kurz an!“ und dann machte ich das Foto.

Eine Familie im Garten, so ein bisschen im Hintergrund, um einem Tisch herum. Ein ganz bescheidenes DDR-Haus, mit einem eigenartigen Gartentor und die Haustür mit farbigem Streifenvorhang verhängt. Es war ein sehr stürmischer Tag, und die Bänder wehten und wirkten sehr lebenslustig. Da habe ich gleich mehrere, vielleicht vier, fünf Negative vom 36er-Film belichtet. Eins ist wirklich gut geworden. Dieses ist ein typisches Bild für mich. Da ist so was Lockeres. Ein Schnappschuss aus der Hand. Dieses Motiv wollte ich so, es hat eine Magie. Man hat ja den Vorhang im Vorbeifahren wehen gesehen. Da kam so ein schöner Wind rein. Das ist fast eine kurze Filmszene und jetzt ist es ein Foto. Film wäre blöd. Denn dort wird es ja vorgekaut. Beim Foto existiert noch der Abstand zum: was es war. Schon vorbei. Jetzt ist die Fantasie des Betrachters angeregt, sich das vorzustellen, was passiert ist. Ich mag diese Atmosphäre.
Die sichtbaren Objekte, die einen umgeben, werden über die Jahre eingeordnet in Bedeutungen, die man interessant findet. Zum Beispiel diese Streifen hängen herunter und sind dadurch willenlos dem Wind ausgesetzt. Das ist ein klassischer Gegensatz zum üblichen menschlichen Wunsch, meist alles zu fixieren.
Ich sah das Bild im Nu vor mir auftauchen: Im Hintergrund, sehr abstrakt, ein Familienidyll. Mehrere Kinder, ein Erwachsener aufgelöst gegen den Himmel. Dann ist da noch eine Art Gartentisch. Diese sehr einfache Hausfassade, der etwas dunkle Türeingang. Und dann eben dieses Lebendige. Vorne das Lebendige, ein durch den Wind in Bewegung gebrachter Vorhang, hinten die spielenden Kinder.
Die Grundfarben sind alle dabei. Nicht die matten DDR-Farben, sondern es war ja 1996, also bereits Westfarben. Ich habe jetzt beim Printen genau darauf geachtet, dass es die richtigen Farben sind. Es ist eine berührende Welt. Hinten die fröhlich tobende Kinderschar, die aber nur so ganz leicht angerissen ist, mehr so in Pixeln dargestellt, in Körnern erlebbar. Und da dieses Selbstbewusste: Wir sind es, also die Tür, diese Streifen sagen „uns geht’s aber gut“. Sie lassen sich gerne bewegen. Ob sie Identität haben? Das flirrt so dazwischen. Ob Identität oder nicht, die nehmen sich einfach diese Identität. Und sie sind eine Geste. Es entsteht ein Dazwischen, eine Zwischenwelt.
Das Bild fängt einfach eine Sonntagsstimmung ein. Für mich ist diese Assoziation auch deswegen interessant, weil ich gerade Mecklenburger Gegenwind auf dem Fahrrad kennenlernte und ich war so richtig in der Wildheit der Landschaft. Da stand ein Häuschen und ich erinnere mich, dass wir unterwegs zu einem Auswärtsspiel von Blau Weiß Basedow waren. Etwas, was mich optimistisch stimmt. Die kleinen Ereignisse, die wirklich große Erlebnisse sind. Der Mensch lebt ja immer wieder in Freude und Leid und versucht immer dafür zu sorgen, dass er meist Freude hat. Was ja Quatsch ist, es funktioniert nicht. Aber diese kurzen Momente, wo du merkst, dass Menschen etwas Gutes sind. Es versöhnt einen sozusagen mit dem, was überhaupt in der Welt abgeht. Was 1996 leichter war als heute oder vielleicht heute nötiger als damals. Weil man heute eine Welt hat, die am Zerbrechen ist. In einer starken Veränderung, immer stärker. Und damals hatte man eine Welt, die in einer relativen Balance intakt schien. Die man doch als sehr intakt gefühlt hat.
Momente, Karma, Hoffnung
Also diese Hoffnung, ja, die Hoffnung, die interessiert mich sehr. Ja, das könnte man ja auch in einem schönen deutschen Wort sagen: Zuversicht. Die Welt wird besser durch sensible Erlebnisse.
Bei Steinert wird man Fotojournalist, bei Becher wird man Künstler. So kann man’s sagen. War damit alles klar? Sagen wir mal so: Ich will gute Fotografie machen und der Rest ergibt sich dann von selbst.
Die Bechers, die hatten was ganz Herzliches. Natürlich, wenn man Serien machen will, muss man auch konsequent einer Art Katalogisierung arbeiten.
Ich habe mich zwar immer als Künstler gesehen, aber bin geschickt genug, das nur selten zu zeigen. Es stört, wenn man beim Arbeiten zu sichtbar ist. Etwas mehr Initiative zum Einbringen in die Vermarktung hätte wohl nicht geschadet. Ich bin in die Taxiwelt gegangen. Es hat auch Vorteile, unabhängig zu sein.
Am Donnerstagabend war hier ein Kunde, der kam vorbei. Kann ich schon mal reingucken? Sagt er: Das Bild verkaufst du nicht, das nehme ich. Ich komme morgen und kaufe das. Freitag früh rief er an. Hey, ich habe da nochmal darüber nachgedacht. Ich bin finanziell doch nicht so stark gestellt. Sorry. Kannst Du’s an wen anders verkaufen? Das war nun der Bumerang der Taxifahrt zum Staufenplatz.
Ein Lieblingsthema ist eine Mischung aus spontanen Bildern, spannenden Entwicklungsphasen in unserer Industrie, in unserer faszinierend wahnsinnigen Welt, wo viele Dinge immer wieder gleichzeitig ablaufen und dann aber auch oft Motivation aus dem konservatorischen Aspekt, dass dieses aussagekräftige Motiv da einer mal fotografieren muss und manchmal muss man sich ranhalten. Denn nicht alle Objekte sind von Dauer und es tut weh, wenn sie plötzlich abgerissen oder verschwunden sind. Das Feedback zu meinen Fotos kam in den letzten Jahrzehnten meist über Kollegen oder andere Fachleute.
Dieses Autodidaktische ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Ich möchte, dass jedes Bild eine Qualität hat. In dem Moment, wo ich es sehe, bin ich begeistert. Macht schon Klick hier oben. Ich weiß dann schon, in welcher Kategorie das Bild eine Rolle spielt. Beim Bild mit dem wehenden Vorhang wusste ich gleich, große Freiheit.
Es gibt auch Phasen, wo man gar nicht auf der Suche ist. Wo man einfach sagt, ich bewege mich jetzt mal nicht optisch sensibel, sondern beschäftige mich mit ganz anderen Dingen. Und dann kann es trotzdem passieren, da: „Stop, Moment mal.“ Das Bild passiert schon.
Kindheit im Bungalow
Meine Eltern waren Jahrgang 1920 und 26 und bereits aus der Moderne. Ich bin in Odenthal groß geworden. Odenthal ist von hier aus hinter Leverkusen. Das ist der erste Anstieg zum Bergischen Land. Meine Eltern hatten keine klischeehafte, bürgerliche Attitüde. Die war ja auch nicht zwangsverordnet in den 1970er Jahren. Sie hatten sich einen modernen Bungalow bauen lassen von Erwin Zander aus Köln. Der war ein Meisterarchitekt. Einfache, klare rote Ziegelarchitektur mit hohen schwarz eingerahmten Fenstern. Etagenübergänge in Sichtbeton mit Schalbrett-Oberfläche. Wir waren mit der Kölner Kunstszene befreundet und oft kamen interessante Leute aus Köln zu Besuch.
Ausstellung im DFI-Projektraum

Die Messe-Bilder der Ausstellung sind nicht zuversichtlich. Sie zeigen eine Welt, die sich skurril vor sich hin entwickelt. Sie zeigen Leute in einer gewissen Befangenheit, Skepsis oder sie wissen gar nicht, wohin es geht. Da gibt es die drei Frauen, die rauchen. Was sie wohl gerade miteinander besprechen?
Alle anderen Menschen, die ich fotografiert habe, wirken ein wenig verloren. Weil die Welt, die wir uns da alle geschaffen haben, Systeme, Konzerne und Märkte uns eine rätselhafte Heimat bieten, die uns unsicheren Halt verleiht.
Eine simulierte Kulissenwelt. Das liebe ich natürlich. Dubiose Kulissen. Da sitzen Personen, einem höheren Auftrag nach Repräsentation gehorchend, aber die Bilder zeigen ja, ihnen wird wie selbstverständlich ein Platz zugewiesen. Wie eigenartig dieser Platz wirkt in diesen Kulissen und Anzügen, mit passenden Frisuren und Brillen, in diesem zwar aufgepeppten, aber doch banalen Messestand, ist auch anrührend.
Eine Familie, Mutter, Sohn und vielleicht Tochter. Sie sitzen da und bieten Lederspäne auf einer Messe an. Da steht der Kühlschrank, vorne zwei Deko-Reiter. Alles ganz ehrlich. Die komponierte Szene sehnte sich einfach nach Darstellung. Eine zwischen Nachkriegszeit und 1980er Jahren kippende Realität.
Hinterhof in Bilk
Es ist schon provokant, wenn ich 458 Bilder jeweils 10 Sekunden lang zeige, 70 Minuten insgesamt.
Es gibt keine Storyline. Da ist eine Schraubenfirma, die zieht um und die Gebäude werden danach anderweitig genutzt. Dann kommt eine Abrissfirma, die reißt das ab, dann ist da ein leeres Gelände und dann kommt eine Neubaufirma. Am Ende 2025 stehen da Häuser. Das Drama läuft chronologisch ab, ist aber eher eine Historienerzählung in vier Akten.
458 Fotos. Vor drei Wochen fragte mich Moritz, machen wir mal eine Ausstellung? Und ich sagte ja, kein Problem. Die Messebilder fand er genau richtig. Dann habe ich gesagt, ich würde aber auch gerne noch diese Hinterhofbilder ausstellen, um einfach auch mal zu testen, wie finden die Leute sowas?
Es gibt davon zigtausend. Mein Ziel ist eigentlich, aber das Ziel grenzt an Größenwahn, die verschiedene Zeiten miteinander zu kombinieren. Ich mache da Fotomontagen draus. Das ist der nächste Schritt. Das ist ein hochkomplexer Prozess. Ich kombiniere oder konfrontiere verschiedene Figuren aus verschiedenen Aufgabenbereichen, aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Bildern, Stimmungen. Alle aus diesem Hof, die an der Stelle waren, kann ich ja miteinander in Dialog bringen. Auch die Tageszeiten, die Jahreszeiten, Regen, Sturm, Sonnenschein, Schnee.
Da ist diese Unendlichkeit, unfassbar viele Fotos. Um den Überblick zu behalten, habe ich gesagt, alles dieselbe Perspektive, alles aus meinem Küchenfenster, aber mit zwei Objektiven, entweder das 85er, ein bisschen telemäßiger oder das 50er, das klassische Normalobjektiv.
Es zeigt den Fortschritt des Baus. Es zeigt auch die soziale Veränderung. Heute wohnen wohlhabende Leute da. Damals war es eine Firma mit Arbeitern. In dieser Zwischenzeit nach dem Auszug der Firma haben die Menschen das genutzt, wie sie wollten. Und da sind eben auch viele Dinge passiert. Ich weiß nicht, ob du die spielenden Kinder nach der Sonntagsmesse gesehen hast. Nur acht Bilder, das war eben nur selten. Lebendige menschliche Szenen einfach. Ich bin ja ein großer Freund der Stadion-Perspektive. Die Aufsicht von 28 Grad ist für mich immer ein ganz wichtiges Thema und hier hatte ich sie. Ich liebe es, wenn man eine Übersicht über ein Feld hat, auf dem sich Dinge abspielen. Wo dann eben die Pieter Bruegel-Situationen sind, einem Idol von mir, wo dann eben menschliche Verhaltensweisen stattfinden und auch Interaktionen. Verschiedene Personen zeigen sich auch, indem sie sich für Portraits zurechtstellen. Zum Beispiel der grandios gekleidete Mann, der die Position vor seinem Auto als passende Kulisse wählt, die Fussballfans, die ihre Gruppe als Darstellung des Gemeinschaftsgefühls sehen oder der Kybernetik-Experte, der mit zwei Grazien den Begriff ‚aufwärts‘ darstellt.
Du hast ja diese leere Landschafts-Phase jetzt gesehen? Darauf aufbauend könnte ich Situationen oder Objekte addieren. Und das kann alles in die Mitte, in die Luft, überall hin. Ich kann ja alle Fragmente nutzen.
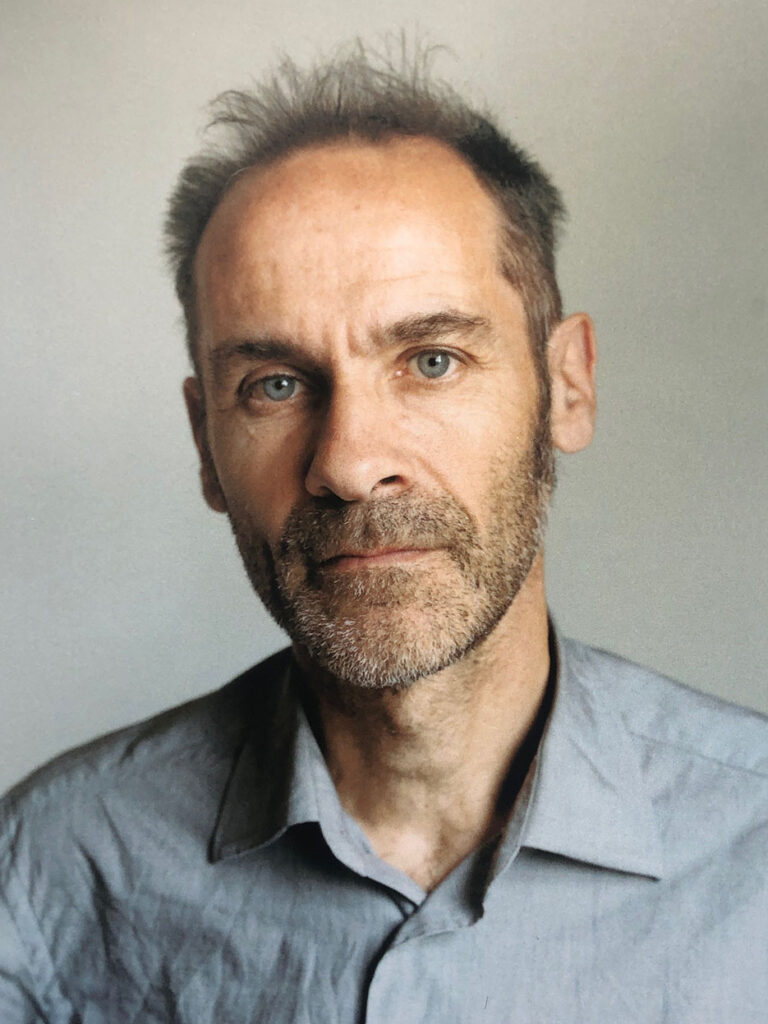
Das Projekt ist so umfangreich, dass ich froh bin… ich habe einen Freund, der Albert Kamps. Und der begleitet mein Schaffen oft, wenn ich sage: „Das ist passiert oder das…“ Er sagt: „Ja, mach doch mal was, zeig doch.“ Ich sage: „Ich brauche noch -“ Albert arbeitet als Rechercheur und schreibt Essays, Kurzgeschichten, der hat immer angeschoben und hat gesagt: „Mach doch mal was daraus.“
Dann kam der Moritz Wegwerth vorbei, das passte genau richtig. Genau jetzt konnte ich sagen, ich bin in der Endphase, die Häuser stehen da. Ich mache aber keine Baudokumentation, das war diesmal das Abschlussbild und die leuchten schon, die Lampen sind an. Aber es wurde ja diese ganze Welt, die sich da in den siebzehn Jahren abgespielt hat, erschaffen. Das wäre eine nächste Ausstellung, die nicht chronologisch ist. Und da bin ich der freie Komponist.
Das ist eine unglaubliche Langzeitstudie. Siebzehn Jahre. So von da nach da. Und alle Zwischenlagen. Jetzt wohnen dort mehrheitlich schicke Leute, wohlhabende ältere Leute, aber auch junge, auch viele sind da mit kleinen Kindern. Suitbertusstrasse, Bilker Bahnhof, Merowinger Straße. Da war früher alles Industrie. Diese Schraubenfabrik war eben auch noch übrig geblieben. Gegenüber war auch alte Industrie, danach Auto Becker, dort sind vor zehn Jahren auch neue Wohnungen entstanden. Jetzt ist das Mothes Karrée fertig. Tecklenburg hat’s gebaut. Nicht typisch ökologisch. Der hat zwischendurch auch wegen der Zinswende Konkurs gemacht, aber das ist alles wie geplant weitergelaufen. Wohnungen kosten zwischen fünfhundert Tausend und eine Million. Jetzt wohnen da die neuen Leute.

Hinweis:
Annette Kelm: Die Bücher im DFI-Projektraum
Eiskellerberg 1, 40213 Düsseldorf
Die Eröffnung ist am 29. Nov. 2025
Lesen Sie weiter
Als Peter Lindbergh noch Sultan war
Ein äußerst konstruktiver Mensch