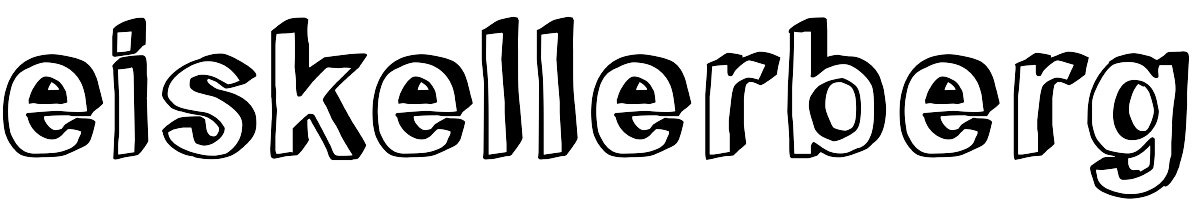Eine Würdigung von Robert Fleck
„Robert, Herbert ist heute gestorben. Ich kann es nicht glauben und nicht akzeptieren. Du musst jetzt wieder mitarbeiten.“ Sonntagabend, 27. Juli, meldete sich Rosemarie Schwarzwälder, seit 1995 die Galeristin von Herbert Brandl, in diesem langen Zeitraum immer seine Hauptgalerie, die ihn und seine Arbeit mit ihren vielen internationalen Messebeteiligungen auch durch schlechte Zeiten trug, wie in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren, als Malerei nur noch ganz marginal angesagt war. Ich hatte Herbert Brandl in ihrer Galerie kennengelernt, etwa 1981, als er noch an der Hochschule für angewandte Kunst studierte und ich der Helfer war in der Galerie, welche zu diesem Zeitpunkt neben der Galerie Ursula Krinzinger (damals in Innsbruck) als einzige internationale Galerie aus Österreich heraus agierte.
Als die Nachricht kam von Rosemarie, sah meine Frau Patricia bei uns in der Bretagne einen Film. Ich war daneben am Computer. Als ich zu ihr sagte: „Herbert Brandl est décédé“, schaltete sie augenblicklich den Film und den Bildschirm ab. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte das noch nie bei ihr erlebt. Dann war sie auf ihrem Handy, was ich nicht recht verstand. Doch sie ging Herbert Brandls facebook-account durch. „Wie kommt das? Schau mal seine Nachricht vor drei Tagen, wie meist zu Natur- und Tieranliegen. Er war so engagiert.“ Da ich nicht auf den Sozialen Netzwerken bin und Herbert nur selten auf Mails oder Anrufe antwortete, hatte ich ihm in den letzten Jahren bisweilen über Patricias facebook-Account geschrieben.
Verzeihen Sie bitte diesen persönlichen Gesichtspunkt, denn so legt man eigentlich keinen Artikel über einen Künstler an. Doch es ist möglicherweise auch von objektivem Interesse, für die Frage, was spielt sich eigentlich ab, wenn ein Ausnahmekünstler stirbt? Dazu gibt es wohl keine kunsthistorische Studie. Das Thema wäre es wert.
Man weiß kaum, dass die Nachrufe in den französischen Zeitungen auf Pablo Picasso bei seinem Ableben 1973 ausnahmslos negativ waren: „Schlechter Maler, das einzig Gute ist der Kubismus, aber den hatte Georges Braque erdacht“. Daraufhin taten sich Maler wie Hans Hartung und André Masson zusammen und publizierten eine Mappe „Hommage à Picasso“, bevor zehn Jahre später die Generation von Herbert Brandl Picasso wiederentdeckte und ihn über sein Spätwerk als den wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts durchsetzte.
An diesem Sonntagabend war plötzlich Herbert Brandl tot. In 45 Jahren hat man das Ableben sehr vieler Leute erlebt, für die man arbeiten konnte. Wenn man sich die Liste überlegt, wird sie endlos. Terry Fox, Robert Filliou, Joseph Beuys, Meret Oppenheim, Absalon, Felix Gonzalez-Torres, Martin Disler, Friedensreich Hundertwasser, Michel Majerus, Raymond Hains, Otto Mühl, Franz West, Sturtevant, Maria Lassnig, Christian Boltanski, Pierre Soulages, Herman Nitsch, Peter Weibel, Gunter Damisch, Brigitte Kowanz, jetzt Herbert Brandl.

Auch die Liste der verstorbenen Kunstvermittler und Ausstellungsmacher, wie man in den 1970er und 1980er Jahren sagte, also Museumsleute und Kuratoren, mit denen man arbeiten und von denen man lernen konnte, nimmt schier kein Ende: Kasper König, Werner Hofmann, Harald Szeemann, Jean-Christophe Ammann, Klaus Bußmann, Pontus Hulten, Jan Hoet, Wolfgang Max Faust, Okwui Enwezor, Peter Weibel. Und das ist nur eine kleine Auswahl.
In dieser ersten Reaktion auf den Tod von Herbert Brandl erfährt man einen André Malraux-Effekt. Malraux war ein begnadeter Romanautor, zwielichtiger Abenteurer und einer der Organisatoren des französischen Widerstands gegen die deutsche Besatzung. Er publizierte in der Nachkriegszeit ab 1947 eine Reihe von einflussreichen kunsthistorischen Büchern, obgleich er kein Kunsthistoriker war. Ihr Generaltitel lautet: „Das imaginäre Museum“ Mit der fotografischen Reproduktion und dem Offsetdruck sei die gesamte Kunst der Menschheitsgeschichte für die Künstler unserer Gegenwart visuell verfügbar geworden. Malraux dachte das im Medium Buch. Heute macht das auf andere Weise das Internet.
Herbert Brandl war ein Maler des Malraux’schen „Imaginären Museums“. In den frühen Jahren waren Klimt und der Byzantinismus für ihn ein wesentlicher Bezug, aber auch – darüber sprachen wie leider nie, weil wir ja nicht dachten, dass wir uns nicht mehr sprechen würden – der Pointilismus, insbesondere jener von Giovanni Segantini, der in die frühe Secessionistische Tradition in Wien ab 1898 die Techniken des französischen Divisionismus oder Neo-Impressionismus von Georges Seurat und Camille Pissarro einbrachte, auf welche wiederum in Herbert Brandls Studienjahren an der Hochschule für angewandte Kunst deren Rektor Oswald Oberhuber immer wieder hinweis.
An Malraux bei dieser imaginären Liste der Verstorbenen zu denken, erbringt aber auch die andere Seite seines Enturfs des „imaginären Museums“. Wer in den Zeitaltern des „imaginären Museums“ – heute durch Internet erfasst, in dessen Bilderwelt Herbert Brandl seit Mitte der 2000er Jahre stets sehr verortet war, bevor er ein Bild überlegte, dann sehr spontan und überaus schnell anlegte und malte – denkt, hat man es (bei Malraux mehr als auf Instagram) mit einer unabschätzbaren Anzahl toter Künstler zu tun. Malraux‘ „imaginäres Museum“ prägte Brandl, der ja aus einer Generation kommt, in der man als Jugendlicher und Student weder die Personalcomputer, noch mobile Telefone, weder Internet noch Soziale Netzwerke und ihre neuen Bilderwelten erahnte, versetzte die lebenden Künstlerinnen und Künstler ähnlich wie der Louvre in die Gegenwart von unglaublich vielen verstorbenen Künstlerinnen und Künstlern. Das ist einerseits schrecklich. Andererseits gibt es den sehr guten Satz von Malraux, den Gilles Deleuze, mein Lehrer, knapp nach seiner Emeritierung in einem denkwürden Vortrag „Was ist der schöpferische Akt?“ (Qu’est-ce que l’acte de création) in der Filmhochschule Femis zitierte: „Die Kunst ist die einzige Sache, welche die Menschheit erfunden hat, um den Tod zu besiegen.“

So schrieb ich Rosemarie Schwarzwälder an diesem Abend nach einiger Zeit zurück, jetzt sei es unser Job, mit Edelgard Gerngross, Herberts Partnerin, für die Nachwelt dieses Werks zu sorgen und dass es auf diesem Niveau der internationalen Anerkennung bleibt. Herbert Brandl war seit Jahren, zu seiner eigenen Überraschung, vom Wirtschaftsmagazin Trend Jahr für Jahr per Titelseite zum bedeutendsten lebenden Künstler in Österreich gewählt, durch eine Jury österreichischer Kunstleute. Die Fondation Louis Vuitton und viele Spitzensammlungen haben in den letzten Jahren museumsreife Werke von Herbert Brandl erworben. Dazu wiederum war die Galerie in Wien, mit ihren weltweiten hochkarätigen Messebeteiligungen, ausschlaggebend.
Eigentlich reicht dies schon, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wer Herbert Brandl war. Verzeihen Sie mir bitte, noch zwei Gesichtspunkte hinzuzufügen.
Herbert Brandl war etwa 1980 erstmals in der Galerie nächst St. Stephan in der Wiener Grünangergasse 1. Die Galerie bildete eine der anerkanntesten Galerien der Kunstwelt, war aber noch ein Betrieb fast ohne Kunstverkauf, denn 40 km weiter verlief der Eiserne Vorhang und es kamen keine ausländischen Käufer. Wie auch zwei andere, gleichfalls weiblich geführte Galerien lud man ausländische Künstlerinnen und Künstler ein, die nirgendwo sonst in Österreich gezeigt wurden. Man definierte sich als Informationsgalerie. Die ausländischen Künstlerinnen und Künstler verkauften nichts in Wien, aber es war ein Ort internationalen Ansehens und sie erhielten ihre Kosten für Reise und Aufenthalt ersetzt.
Das war der Kunstbetrieb der späten 1970er Jahre, den Herbert Brandl ab 1979 als Student an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien erlebte, wo im gleichen Jahr Joseph Beuys, Bazon Brock, Karl Lagerfeld und Peter Weibel lehrten, was eine Aufbruchstimmung auslöste. Herbert Brandl war durch seinen Kunstlehrer Wolfgang Temmel am Gymnasium in Deutschlandsberg mit internationaler Konzeptkunst sozialisiert, malte aber ein erstes Bild. Sein Klassenleiter Herbert Tasquil sagte entsetzt: „Hängen Sie diese Peinlichkeit ab! Beuys macht einen Rundgang durch alle Klassen.“ Doch Joseph Beuys stand schon da, besprach das Bild mit Brandl positiv und ermutigte ihn, weiterzumachen. Nicht nur für Herbert Brandl, sondern für diese ganze Generation in Österreich änderte die kurze Gastprofessur von Joseph Beuys den künstlerischen Horizont.
Die Galerie nächst Stephan betrieb zudem die einzige Kunstbuchhandlung Österreichs. Rosemarie Schwarzwälder und ihre Assistentin Heidi Caltik ließen die Studierenden, die mehrheitlich aus der ‚Angewandten‘ kamen, die internationalen Kunstzeitschriften lesen, die es nur hier gab. So lernte man einander kennen, man war ja gleich alt. Eines Tages sagte Heidi Caltik zu mir: „Zwei werden richtig gut, Gerwald Rockenschaub und Herbert Brandl.“
Mit Gerwald Rockenschaub hatte ich drei Jahre zuvor Geschichtswissenschaft an der Universität Wien angefangen. Plötzlich waren wir beide in der Kunst. Er kam mit seinem sehr originären Umgang mit dem Zeichen als einziger dieser Generation in den 1980er Jahren in die Galerie von Rosemarie Schwarzwälder, denn Herbert Brandl schnappte uns Peter Pakesch weg, der 1982 seine Galerie in der Ballgasse eröffnete und die besten seiner Generation um sich scharte.
Über Herbert Brandl sagte Heidi Caltik: „Das wird der Beste. Habe ihn lange beobachtet, wie er schauen kann.“ Sie vereinbarte mit ihm, dass wir ihn in der Südsteiermark, wo er, 1959 in Graz geboren, auf dem Land aufgewachsen war, besuchen würden. Der Ort heißt Schwanberg. Da hat sich Herbert in den letzten Jahren sehr engagiert gegen das Projekt eines Wasserkraftwerks eingesetzt, das der Fürst von Liechtenstein, der größte Waldeigentümer in Österreich, da betreibt. Herbert Brandls Schwarze Sulm-Projekt von 2015 ist ein exemplarisches Beispiel dafür, was Künstlerinnen und Künstler in der öffentlichen Diskussion der Gegenwart leisten können, aus der Malerei heraus. 1981 sagten wir uns bei diesem Besuch bei Herbert, als er uns in das südsteirischen Mittelgebilde mitnahm: „Kann der schauen! Das wird etwas.“ Die Natursensibilität ist auch tatsächlich eine Grundlage seines Werks. Sein kleines bäuerliches Haus am Rande von Schwanberg hatte damals weder Fließwasser noch elektrischen Strom.

Ein Jahr später, 1982, stellte Walter Pichler, Bildhauer mit ähnlicher Natursensibilität und unweit von Brandl wohnend, im österreichischen Pavillon der Biennale von Venedig aus. Er drehte sich beim Ausstellungsaufbau einmal um und sagte, ich solle mir den Pavillon gut ansehen, denn ich würde ihn irgendwann einmal kuratieren. Herbert Brandl fuhr im gleichen Sommer mit zwei Studienkollegen auch zur Biennale. Sie beschlossen im Pavillon, alle da mal auszustellen.
Für Gerwald Rockenschaub ergab sich das 1993 mit Peter Weibel als Kurator. Herbert Brandl konnte ich 2007 einladen und wusste vorab, er hat das Gespür, die Professionalität und die innere Sicherheit für einen Ausnahmepavillon. Es war damals der einzige Nationalpavillon mit Malerei auf dieser Biennale. Übrigens erzählte kürzlich Christoph Westermeier, der zu diesem Zeitpunkt an der Kunstakademie studierte, Markus Lüpertz habe als Rektor in seinen Reden zu den Rundgangseröffnungen stets nur allgemein über Kunst gesprochen, mit einer Ausnahme. Im Januar 2007 sagte er, die Kunstakademie habe eine hohe internationale Stellung. Das zeige sich daran, „dass unser junger Kollege Herbert Brandl mit einer Einzelausstellung den österreichischen Pavillon der diesjährigen Biennale von Venedig bestreitet“.
Seine Galerie nächst St. Stephan – Rosemarie Schwarzwälder schrieb im Nachruf auf Herbert Brandl, er sei der bedeutendste lebende österreichische Künstler gewesen. Daraufhin fragte mich Carl Friedrich Schröer: „War er also der Gerhard Richter von Österreich?“ Eine sehr gute Frage. Ich möchte sie auf drei Ebenen beantworten.
Er hatte es hinbekommen, der wichtigste lebende Künstler in Österreich zu sein, gleichsam ein lebendes Symbol. Das war nicht sein Plan. Er war stets entschlossen, auf dem höchstmöglichen Niveau zu arbeiten, und gleichzeitig ein sehr netter, bescheidener Mensch. Als bei seiner Einzelausstellung im österreichischen Pavillon der Biennale von Venedig 2007 zur Eröffnung der Bundespräsident, der Bundeskanzler und fünf Ministerinnen und Minister auf der Rednerbühne standen, ahnte man, dass er zu einem Symbol in seinem Geburtsland aufstieg, wie in Deutschland Gerhard Richter und in Frankreich Pierre Soulages. Wie diese hat er sich immer sehr gut der Medienaufmerksamkeit entzogen.
Der österreichische Gerhard Richter‘ also? Angesichts des Niveau- und Bedeutungsunterschieds der österreichischen und deutschen Kunst hat der Vergleich etwas von einem Schimpfwort. Er ist aber interessant. Werke beider Künstler sind einander ohne ihr Zutun oft begegnet. In der Grande Biennale de Paris 1985, an der documenta 9 1992, in Der zerbrochene Spiegel von Kasper König und Hans Ulrich Obrist 1993 hingen die Bilder beider Künstler in räumlicher Nähe, weil sie über die Generationen hinweg eine Verwandtschaft besitzen. In der documenta 9 von Jan Hoet, wo Denys Zacharopoulos ihn einlud, hing Brandl abstraktes Bild an der Außenwand des provisorischen Ausstellungsgebäudes, in dem Gerhard Richter den zweiten der beiden Säle hatte.
Herbert Brandl nahm in den letzten zwanzig Jahren als Maler eine internationale Stellung ein, die über das – recht hohe – Preisniveau seiner Werke hinausgeht. Das zeigen Bekundungen ehemaliger Professorenkollegen an der Kunstakademie Düsseldorf nach seinem überraschenden Tod.
Peter Doig schrieb mir: „I got to know Herbert when we both were in Salzburg for the Eliette von Karajan Prize in 1994 and subsequently saw each other in Vienna and then as colleagues at the Kunstakademie Dusseldorf. I was really saddened by the news of his early passing. He was a brilliant and unusual painter who was always doing his own thing with the medium. RIP Herbert.“ Christopher Williams: „Generous, super fun, sharp as hell. My time at the Akademie would not have been the same without him and times in Vienna would certainly not have been as fun. Saddened.“ Die Nachricht von Tal R zeigt schön, wie sehr Herbert Brandl Teil dieses internationalen Niveaus war: „Love to Herbert. Very best. Tal“ Katharina Fritsch: „Es ist sehr traurig, er war ein sehr feiner Mensch, ich hab ihn von den sonst so überehrgeizigen Kollegen wirklich gemocht. Und ein wirklich sehr, sehr toller Maler!!! Das sag ich nicht oft.“ Hans Ulrich Obrist: „Herbert Brandl was a great artist and a great human being. I remember our many dialogues and his persistant conviction that painting could still surprise itself. The intensity of Herbert Brandls work remains very much alive and will continue to inspire many generations to come.“ Suzanne Pagé, Gründungsdirektorin der Fondation Louis Vuitton: „Ich hatte den größten Respekt für den Maler, einen wirklichen Großen, mit einer starken Singularität, die völlig authentisch war, im Farbauftrag und in der Art der Verbindungen der Farben innerhalb sehr persönlicher Tonreihen, sowie in der Wahl der Sujets natürlich. Sie sind nicht so zahlreich auf diesem Niveau. Aber ich habe auch viel Sympathie für den Menschen, so tiefgehend nett und offenherzig.“
Ebenso interessant ist bei einem Vergleich mit Gerhard Richter die Frage, was Herbert Brandl im Innersten seines Werks als eigenständige Idee und Leistung verfolgte und aufbaute. Gerhard Richters Werk wird von einer Bedeutung getragen, mit der er alleine dasteht, den innigen Dialog von Fotografie und Malerei zum Grundgesetz der Malerei seiner Zeit gemacht zu haben, für sich und für unzählige andere. Er erfand eine neue Vision der Malerei aus der Fotografie, welche auch seine abstrakten Bilder trägt und deren Unabhängigkeit von den vorherigen Traditionen der Abstraktion im 20. Jahrhundert erklärt. Dazu kommt eine sonst unerreichte malerische Qualität und eine enzyklopädische Revision sämtlicher Malereigattungen.

Herbert Brandl war kein enzyklopädischer Künstler, obwohl die Spannbreite seines Werks im neuen Jahrhundert mit den figuralen Bergbildern und ihren Folgen, den Tierbildern und Tierskulpturen atemberaubend wurde. Was gelang ihm in seiner und für seine Generation? Zunächst ist sein Werk sehr unabhängig von Richters Fotografiegedanken in der Malerei, der bis heute in seiner und den nachfolgenden Generationen eine große Rolle spielt, oft auch als Krücke für Malerei. Auch die Monochromie ist hier als Paradigma und Hilfskonstruktion ausgeschlossen. Sein Werk der 1980er Jahre ist von der Idee geprägt, mit anderen Mitteln, die noch zu finden waren, an eine neue, lebendige abstrakte Malerei heranzukommen. Die Bilder dieser Jahre sind sehr dicht, in unzähligen Farbsetzungen geschaffen und über längere Zeiträume gemalt, wobei immer mehrere Bilder zugleich entstanden.
Die Gemälde der 1980er Jahre weisen eine atomare, extrem vielteilige Struktur auf. Sie bilden unüberschaubare Rhizome. Der Rhizom betitelte Text von Gilles Deleuze und Félix Guattari von 1976, in der deutschen Ausgabe bei Merve, hatte um 1980 große Auswirkungen in der jungen Kunst. Herbert Brandl übernahm sehr direkt die Idee, eine Unkrautstruktur des Gehirns und Denkens sei interessanter als die traditionelle Baumstruktur des Models vernunftgetragenen Denkens und Wahrnehmens. Die von einer Leinwand zur anderen neu entwickelte Bildkonstellationen waren bereits auf eine hochgradige Natursensibilität gegründet, die schon damals im Kontext der Neuen Malerei dieser Jahre nur diesem Maler eignete. Diese frühen Bilder entwickeln daraus ein freies Spiel von Farbe und Licht, das noch ungesehen war und eine große innere Kraft besitzt. Gleichzeitig entwickelte es sich weiter, die Bildstruktur ständig erneuernd. Dies wiederum machte es aus, dass er zehn Jahre nach seinen Anfängen als einziger Künstler der Neuen Malerei der frühen 1980er Jahre in der sehr guten documenta 9 von 1992 vertreten war.
Ulrich Loock, übrigens Absolvent der Kunstakademie Düsseldorf als Schüler von Klaus Rinke, kuratierte spräer als Direktor der Kunsthalle Bern die erste Retrospektive von Brandl. Auf meine Frage, wie er dazu kam, antwortete er: „Hier deutet sich etwas an, dessen Ende gar noch nicht abzusehen ist.“ Gleichzeitig wurde Hans Ulrich Obrist ein dauerhafter Unterstützer des Werks.
Ab den frühen 1990er Jahren befreite sich Herbert Brandl von der Kleinteiligkeit des ersten Werkabschnitts, die aber auch einen großen Charme besitzt. Er baute sich eine großräumige Bildanlage auf, die ab 1992/93 eine ganz eigene Position im internationalen Kunstgeschehen ergab. Man könnte von einer molekularen Malerei sprechen, die großförmiger angelegt ist als die atomistische Malerei der 1980er Jahre. Sie ermöglicht mehr noch als diese einen malerischen Spielraum, den der Künstler anschließend von einer Bilderserie zur anderen und von einem Jahr zum anderen ausbaute. Farbe und Licht wurden immer unabhängiger von den rhizomatischen Formen, ohne dass diese verlorengingen.
Peter Pakesch hatte 1993 seine Galerie geschlossen, er blieb dem Künstler immer nahe. Bärbel Grässlin in Frankfurt a. M. begann dann mit ihm zu arbeiten, Rosemarie Schwarzwälder ab 1995 mit ihrer Galerie sowie in Innsbruck und Wien Elisabeth und Klaus Thoman bzw. zuletzt Maximilian Thoman. Die seit drei Jahrzehnten durchgehend tätigen Galerien und auch Peter Weibel 2003 mit der Ausstellung in der Neuen Galerie im Landesmuseum Joanneum in Graz haben das Werk dauerhaft abgesichert. Der Biennale-Pavillon war eine logische Folge.

Was entstand da also? Eine neue, rhizomatische Bildgestalt abstrakter Malerei, eine molekulare Auffassung der Bildstruktur, die unterhalb der Wiedererkennbarkeit von Einzelteilen bleibt und gleichzeitig eine unermüdliche, musikalische Variabilität aufweist sowie ein Spiel von Licht und Farbe, das recht einmalig dasteht. Gleichzeitig weisen seine Bilder unterschiedliche Geschwindigkeiten auf. Sie stehen im Dialog, womit sich eine Form des „Zeit-Bildes“ ergibt.
Über diese Details haben Herbert und ich nie ausführlich und erschöpfend gesprochen. Wir dachten ja, wir hätten noch viele Gespräche, über die Jahre gestreckt, vor uns. Vor nicht langer Zeit sprachen wir darüber, dass ich gerne eine theoretische Monographie über ihn und sein Werk machen würde, wie Pierre Soulages es mir 2014 für sich vorgeschlagen hatte, was 2017 mit einem Gespräch von Hans Ulrich Obrist mit dem Künstler erschien.
Das alles geht einem durch den Kopf, wenn das Werk plötzlich abgeschlossen ist, aber weiterleben muss und man im Umfeld des Künstlers damit mitbetraut ist.
Es bleibt noch sehr viel zu bedenken und zu sagen. Das Werk der 2000er und 2010er Jahre hat so viele Beziehungen zu unserer Bildschirmgesellschaft, deren Brandl sich überaus bewusst war, seine Tage am Bildschirm verbringend, wobei die Malerei immer triumphal völlig eigenständig bleibt. Wenn Edouard Manet ab 1863 über das entstehende photographische Bilddenken triumphierte, es malerisch umkehrend, so hat Brandls Werk des neuen Jahrtausends viel mit einer malerischen Umkehrung des bildschirmgeprägten Bilddenkens zu tun. Auch darin liegt die Eigenständigkeit des Werks.
Deleuze insistierte in seinen letzten Vorlesungsjahren auf der Unterscheidung von Begriff (Konzept), Affekt und Perzept. In diesem Spektrum besteht Herbert Brandls Malerei darin, das reine Perzept bearbeitet zu haben, und daraus alles neu aufzubauen. Auch deshalb hat diese Malerei mit unserer Gegenwart viel zu tun.
Herbert Brandl starb am Morgen des 27. Juli an einem Herzversagen. Vor Jahren war er beim Klettern in den Bergen abgestürzt. Das hatte später innere Blutungen zur Folge, die er durch eine vielstündige Notoperation überlebte. Seine Gesundheit blieb fragil, weshalb er auch 2019 nach fünfzehn Jahren die Professur an der Kunstakademie Düsseldorf beendete. Bei unserem letzten Gespräch erzählte er, er habe sich damals nach Monaten im Krankenhaus gegen den Willen der Ärzte selbst entlassen. Ab 18. August ruht er auf dem Wiener Zentralfriedhof in der Sektion der Ehrengräber der Künstler, nicht weit entfernt von Maria Lassnig und Franz West, die für ihn immer wichtige Bezugspersonen waren.
Herbert Brandl wurde am 17. Januar 1959 in Graz geboren und studierte ab 1978 an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien u.a. bei Peter Weibel. Eine „günstige Zeit“, wie er sich einmal erinnerte: „Anfang der 80er Jahre hat sich sehr viel geändert. Vorher war das Interesse kaum da und für Jüngere war es sehr schwierig. Aber dann gab es im Galeriewesen einen Umbruch.“ Und so hat er es, gemeinsam mit anderen „Neuen Wilden aus Österreich“ wie Hubert Schmalix, Erwin Bohatsch oder Hubert Scheibl, bald zu internationaler Aufmerksamkeit gebracht.
Seine ersten Ausstellungen hat er in seinen frühen Zwanzigern, oft in der Galerie Peter Pakesch, 1989 dann auch auf der Biennale Sao Paulo oder 1992 auf der documenta. 1997 erhielt er den Preis für Bildende Kunst der Stadt Wien, der damalige Kulturstadtrat Peter Marboe würdigte dabei Brandls Bilder, in denen zugleich Auflösung und Festigung herrschten. Seine Arbeiten seien voll Dynamik und Sentiment. Zu Brandls weiteren Auszeichnungen zählen u.a. der Prix Eliette von Karajan (1994), seit 2004 lehrte er 15 Jahre lang als Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf.
Lesen Sie weiter