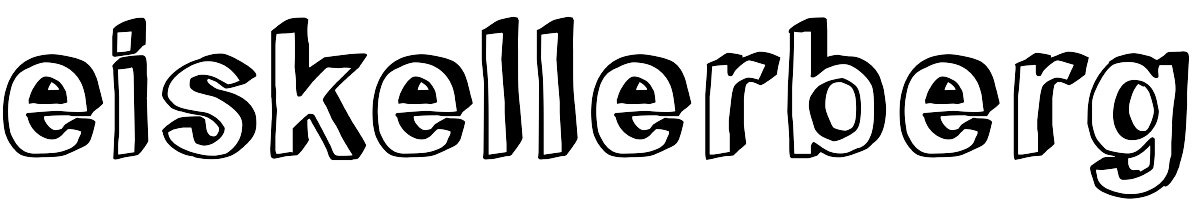~ Von Mariam Mchedlidze, 17.02.2021 ~
✧
Der Blick hinaus liefert nur ein einziges Standbild. In meiner Einzelzelle muss ich mich einrichten, Unterschlupf finden. Was bleibt mir, als mich mit dem Ausblick aus meinem Fenster abzufinden, immerhin bietet er eine ganze Reihe möglicher Perspektiven. Es ist auf Tage hin die einzige Verbindung meines Wohnraums mit dem Draußen, der Außenwelt.
Voller lebendiger, wahnhafter Vorstellungskraft über Farben, die gar nicht dort zu sehen sind, trifft mein Blick immer wieder das gleiche halb pinke, halb graue Gebäude, das nicht einmal bei Nacht zu der Art von Leben erwacht. Dennoch lässt sich aus sicherer Distanz das Leben fremder Menschen beobachten. Ist es mehr Schutz oder Ohnmacht zu denken, dass sich diese Gegenüber, diese Parallelwelten wahrscheinlich niemals treffen werden.
Ich starre in die graue Aussicht, bis sie bunt wird. Nicht nur die bleichen Farben verwandeln sich, werden poppig, auch die verblassenden Formen beginnen ansprechend und aussagekräftig zu werden, als ich beginne, sie auf dem Papier zu zeichnen und nach meinem Geschmack zu verzerren – zum ersten Mal wende ich mich dem Zeichnen von Figuren aus dem echten Leben zu.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Gesetze hinsichtlich einer hellorangenen oder babyblauen Fassadenfarbe eines Hauses eher streng sind, kann ich dies nun auf dem Papier machen, an meinem Tisch, der unter dem Fenster steht. Ich greife zu einer Packung Wachsmalstifte und male bunte Linien auf die letzte Seite meines Notizblocks. Genau wie ich es in langweiligen Erdkundestunden in der 9. Klasse zu tun pflegte. Mit dem gleichen Beweggrund – Versuch das reine Überleben zu retten. Dieses Mal leider ohne die Befreiung durch die schrille Schulglocke, auf deren Signal hin wir alle Rucksäcke schnell zusammengepackt haben und zur Tür hinaus geprescht sind, um das Mittagessen in der glühenden Sonne zu genießen. Heute muss ich auf unbestimmte Zeit dableiben, durchhalten. Und es wird kein sorgloses Mittagessen mit Freunden geben. Im besten Fall wird es einen einsamen Spaziergang in der Stadt geben, während ich mit einer Freundin telefoniere, die mir dann erzählt, wie sie ihre Großmutter im Altenpflegeheim besuchen will, aber nicht hin darf und wie sie nicht mit ihrer Großmutter zu Abend essen kann oder mit ihren Freunden abhängen darf. Einzige Möglichkeit, die der alten Frau blieb, allein spazieren zu gehen oder durch ein Fenster im ersten Stock mit ihren Enkelkindern zu sprechen.
So wie der Spiegel im Spiegel die Unendlichkeit zeichnet, so zeigen auch die gegenüberliegende Glasfenster, die sich gegenseitig anstarren, eine nicht enden wollende Interaktion zweier Parallelwelten, die sich anstarren, ohne einander jemals ihr Gesicht zu zeigen. Sie zeigen sich als Silhouetten, die über dampfenden Töpfen in der Küche schweben und Suppen mit Holzlöffeln umrühren. Diese sind meist nichts anderes als lebendige Einblicke, die den Geist der am gegenüberliegenden Fenster sitzenden Betrachter in der Anerkennung des Lebens im Allgemeinen heben. Anteilnahme als positiver, gegenseitig anerkannter Voyeurismus.
Im Idealfall ist der Ausblick offen und weit und statt fremder Blicke bricht die windige Sonne frei durch leinene oder durchscheinende Vorhänge herein. Wie bei diesem Gemälde von Andrew Wyeth weht eine Energiequelle, sprühende Lebenslust von der Außenwelt zum Betrachter. Trotz des energiegeladenen und extrovertierten Geistes dieses Gemäldes gibt es eine selbstreflexive Perspektive, die Vorhänge weisen auf den Betrachter und ermutigen ihn, das zu verinnerlichen, was der Rahmen von der Außenwelt durchlässt.

Die Erfahrung, aus dem Fenster zu schauen, ist eine ganz andere als draußen herum zu spazieren. Dort können unsere Gedanken von einem Bild zum nächsten springen. Im Falle des Betrachtens einer einzigen Aussicht sind wir dazu verurteilt, auf einem Stück Gedanken hängen zu bleiben
So wie unser Körper verharrt, wenn wir abschweifen und dabei einen Punkt anstarren, ohne wirklich etwas zu sehen. Die Vorstellung, in einem eingefrorenen Gedanken festzustecken, wird beunruhigend, also nehme ich mein Notizbuch, um zunächst mit dem bunten Gekritzel meiner Aussicht zu beginnen. Dann schreibe ich weiter darüber, wozu mich das Starren aus dem Fenster gebracht hat.
Mal bin ich dankbar, dass ich einen Ort habe – einen beizbaren Innenraum, in den ich mich zurückziehen kann, um mich vor der Welt zu schützen, in der wir jetzt leben, und um die Welt auch vor mir selbst zu schützen. Mal kommen Gedanken über die Perspektive, die Innen/Außen-Dynamik, die mir immer wichtig ist, aber angesichts der amtlich verordneten Isolation ist das ja praktisch alles, worüber ich schreiben möchte.
Durch die existenzielle Hysterie, die uns in Pandemiezeiten alle von Zeit zu Zeit einholt, ist es wichtig für manche Momente vom Boden abzuheben. Vielleicht klingt dies etwas, nun ja, abgehoben, also fange noch einmal an: Was ich meine ist Folgendes – sich einen Schritt von der tatsächlichen Form der Dinge zu entfernen, kann eine klarere Form offenbaren. Die Sicherheit, die Gefahr, sie waren alle in diesem Raum und im Gegensatz zu dem, was draußen passierte, konnte ich sie beherrschen. Ich konnte kontrollieren, was ich sah, indem ich kontrolliere, was im Inneren passiert – vor allem mich selbst. Als ich mich für eine lange Weile mit immer der gleichen Aussicht konfrontiert sehe, lerne ich mit verschiedenen Stimmungen umzugehen. Ein gehobener Blick half mir durch mein Leben im Inneren. Es ist schwer zu beschreiben, was die Fußgänger, ihre Kinderwagen, Fahrräder, Hunde und Autos in mir auslösen, aber ich habe das Gefühl, dass mir diese Vogelperspektive etwas mehr Klarheit und Perspektive verschaffe. Ich betrachtet es aus meiner Sicht, mit meinen Augen, es hängt mit mir zusammen.
Der gehobene Blick machte den Kopf frei und ist ähnlich wie dieses Interieur von Matisse, bei dem der Betrachter das Gefühl bekommt, das Leben im Raum allumfassend zu beherrschen und sogar darüber schwebend, einen Moment der Klarheit erlebt.

Eine weitere wunderschöne Auseinandersetzung mit dem Ausblick aus einem Fenster ist Adolph Menzels Balkonzimmer. Es gibt da keinen Blick nach draußen. Aber Wyeths Sonnenschein und sein strahlendes Wetter sind doch auch hier merklich anwesend, ohne dass sie tatsächlich abgebildet würden. Es gibt eine starke Anwesenheit der sonnigen Straße. Genau wie Wyeths Vorhänge, die sich an den Betrachter richten, um unsere Gedanken und die Außenwelt zu verinnerlichen, ist der Raum im Balkonzimmer mit einfachen, wundervollen Kniffen auf uns gerichtet – Teppichauslegeware, die auf den Boden fallenden Lichtstrahlen sowie die Richtung der auf uns, die Betrachter, gerichteten Bodenpinselstriche. Der leicht erhöhte Blickwinkel, aus dem unser Blick in den Raum fällt, vermittelt ein ausgeprägtes Gefühl der Schwerkraft, es versetzt uns in eine erhebende Stimmung.

Der Raum, in dem ich lebe, verändert das, was ich vom Fenster aus sehe. Es verändert das Wetter, verändert die Aussicht und verändert den Rhythmus, in dem die Schneeflocken fallen, wie schnell meine Augen ihre Bewegung in der Luft wahrnehmen. Caspar David Friedrichs Gemälde Frau am Fenster ist ein großartiges Beispiel, um dies nachzuvollziehen: Das Zimmer ist hier durch sein klaustrophobisches Gefühl introvertiert, aus dem uns die Frau mit ihrem äußerlichen und neugierigen Akt des Blicks ins Fenster rettet – sie projiziert das ganze Universum aus ihrem Zimmer ins Freie.

Am Ende meiner zwölftägigen Isolation kann ich nicht viel mehr tun als mich damit abzufinden, das Leben in Gefangenschaft anzunehmen, oder wie Diogenes sein Leben im Fass anzunehmen, oder wie Kobo Abes Box Man und wie sie alle heißen. Auch am 13. Tag bleibe ich zuhause.