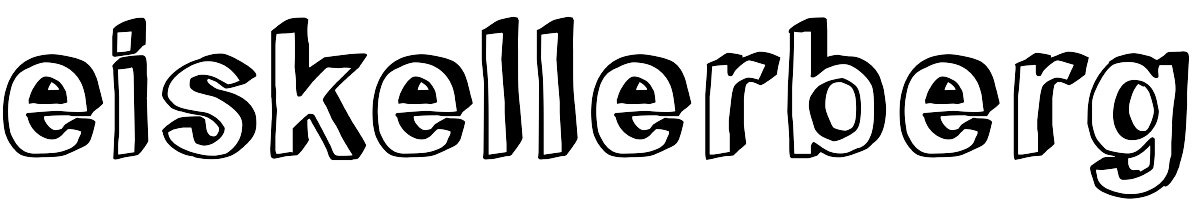Florian Henckel von Donnersmarck wirft sich wieder ins Rennen. Sein neuer Spielfilm „Werk ohne Autor“ läuft im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Am 4. September um 21.30 Uhr wird das Künstler-Drama in der Sala Grande der Biennale Cinema di Venezia seine Weltpremiere erleben. Anschließend läuft der Streifen (188 Min.) beim Festival in Toronto, am 3. Oktober kommt er in die Kinos.
„Werk ohne Autor“ – seltsamer Titel für einen Film über zeitgenössische Kunst. Entsteht Kunst von selbst? Aus sich heraus? Ist der Künstler überflüssig, überschätzt, obsolet? Donnersmarck über den erklärungsbedürftigen Fimatitel: „Wir sind Alchemisten, die das Blei der Traumata in das Gold der Kunst verwandeln können“. Schön gesagt. Oder altes Klischee in neuen Kleidern?
In einem fünfseitigen Spiegel-Interview verrät er uns mehr. Meint er sich da etwa selbst? Und welches Trauma möchte er da in den Goldenen Löwen verwandeln? Vielleicht den Flop seines letzen Hollywood-Fims?
Donnersmarck liebt es, den großen Elia Kazan (1909 in Konstantinopel – 2003 in New York), Regisseur so bedeutender Streifen wie Endstation Sehnsucht (1951), Die Faust im Nacken (1954) und Jenseits von Eden (1955) zu zitieren. Kazan wurde jeweils dreimal mit dem Oscar und dem Tony Award ausgezeichnet. Dieser Kazan also meinte, die Fähigkeit der Schöpfer großer Dinge sei nur der Schorf auf der Wunde, die ihnen in ihrer Kindheit zugefügt worden sei. Das besage, laut Donnersmarck, daß Menschen eine „beinahe alchemistische Fähigkeit besäßen, starke psychische Erschütterungen, in etwas Glorioses zu verwandeln.“ Werk ohne Autor sei ein Blick in diese Alchemie. „Gesehen durch die historischen Traumata meines eigenen Landes, Deutschland“. Da wären wir also wieder beim Thema. Für sein Stasi-Drama Das Leben der Anderen erhielt er 2007 einen Oscar und Donnersmarck galt als das Wunderkind des deutschen Films. Nun greift er auf gleich zwei Traumata der deutschen Geschichte zurück, die Nazi- und die DDR-Zeit. Aus dem doppelten Trauma will er wieder was Glorioses machen. Schon vor dem Filmstart ist Werk ohne Autor von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, zum deutschen Kandidaten für die Oscarverleihung der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt worden.
Wie ja auch seine Hauptfigur Kurt Barnert (gespielt von Tom Schilling) soll auch und dessen historisches Vorbild, der Maler Gerhard Richter, aus dem Trauma ihrer Geschichte, was Glorioses gemacht haben. Richter gilt als bedeutender zeitgenössischer Künstler, genießt Weltruhm und ist der teuerste Maler seiner Zeit. Trotz oder wegen seiner verdammt deutschen Vergangenheit? Aber stimmt die These von der Traumaverarbeitung? Verdanken sich die Bilder Richters einer besonderen Alchemie? Sind sie pure Vergangenheitsbewältigung?
Donnersmarck dreht einen Künstlerfilm und verkennt die Kunst, er nimmt sie nicht mal ernst. Alles ist da historische Verstrickung, üble Vergangenheit. Kunst ist nach Donnersmarck bestenfalls ein Spiegel der „verletzten Seele“, ein Reflex der Verhältnisse, der Zeitumstände, jedenfalls ohne Autor. Eine krude altkommunistische These „Das Sein prägt das Bewußtsein“ (Karl Marx). Für eine eigene Wirkkraft der Kunst bleibt da kein Platz. Als gäbe es keine künstlerischen Fragen, Anliegen, Möglichkeiten, gerinnt im Film alles zu einem dunklen Historiendrama mit SS-Uniformen und Stasi-Mänteln, voller Verbrechen und deren fortgesetzter Verdrängungen, im dem sich die Kunst und die Künstler irgendwie verlaufen haben, herumirren, um doch wieder nur unausweichlich eines zu betreiben, Traumabewältigung.
Aber gibt es nicht auch den Wunsch der Maler, auf sich und ihre Kunst aufmerksam zu machen?
 Donnersmarcks Wirklichkeitsversessenheit wird uns besonders anschaulich in der Szene vor Augen geführt, in der Joseph Beuys, unverkennbar mit Hut und Anglerweste, im Hörsaal der Kunstakademie Düsseldorf vor seine wirklich hübschen Studentinnen und Studenten tritt und ihnen auf schlecht niederrheinisch erzählt, sie seien alles Revolutionäre. Dann schreitet er unmittelbar zur Tat, setzt noch im Hörsaal zwei Wahlkampfplakate, die da auf zwei Staffeleien bereit stehen, in Brand. Schön nach Proporz übrigens, eines zeigt Konrad Adenauer, das andere Willy Brandt. Ach ja: die Kunst und das Leben, Beuys und die soziale Plastik. Es ist eine der plattesten, auch peinlichsten Szenen des Films. Denn sie läßt völlig beiseite, daß sich der aus der DDR geflohene Gerhard Richter und mit ihm viele Studenten und Künstler der Nach-Beuys-Generation von dieser materialistischen Sichtweise abgewendet haben und wieder malen wollten. Mit den Mitteln der Malerei dem Diktat des Sozialen entkommen wollten. Das macht Richter so bedeutend – für die Kunst. Doch an einer Auseinandersetzung der Positionen Beuys – Richter ist der Film leider überhaupt nicht interessiert.
Donnersmarcks Wirklichkeitsversessenheit wird uns besonders anschaulich in der Szene vor Augen geführt, in der Joseph Beuys, unverkennbar mit Hut und Anglerweste, im Hörsaal der Kunstakademie Düsseldorf vor seine wirklich hübschen Studentinnen und Studenten tritt und ihnen auf schlecht niederrheinisch erzählt, sie seien alles Revolutionäre. Dann schreitet er unmittelbar zur Tat, setzt noch im Hörsaal zwei Wahlkampfplakate, die da auf zwei Staffeleien bereit stehen, in Brand. Schön nach Proporz übrigens, eines zeigt Konrad Adenauer, das andere Willy Brandt. Ach ja: die Kunst und das Leben, Beuys und die soziale Plastik. Es ist eine der plattesten, auch peinlichsten Szenen des Films. Denn sie läßt völlig beiseite, daß sich der aus der DDR geflohene Gerhard Richter und mit ihm viele Studenten und Künstler der Nach-Beuys-Generation von dieser materialistischen Sichtweise abgewendet haben und wieder malen wollten. Mit den Mitteln der Malerei dem Diktat des Sozialen entkommen wollten. Das macht Richter so bedeutend – für die Kunst. Doch an einer Auseinandersetzung der Positionen Beuys – Richter ist der Film leider überhaupt nicht interessiert.
Sein Film, sagt Donnersmarck, sei „stark inspiriert“ von einigen Ereignissen aus dem Leben Richters. Aber sein Film sei Fiktion. Er bedient sich der Figur Richters, ohne ihr gerecht werden zu wollen. Am wenigsten nimmt er den Künstler Richter ernst. Er schwadroniert nur ständig von Kunst und Künstlern und tummelt sich in der Kunstakademie wie ein geiler Kaplan im Mädchenchor. Selten sah man die Kunst so peinlich entstellt.
Zwei wirkliche Richter machen dann mit beim Film doch mit. Die Filmmusik stammt von Max Richter, der Filmton von Matthias Richter. Beide sind Meister ihres Fachs. In Zusammenarbeit mit dem Tänzer Wayne McGregor und dem Künstler Julian Opie schrieb Richter zuletzt die Musik zu dem Ballettstück Infra, das 2008 im Royal Opera Haus in London uraufgeführt wurde. Für Darren Almonds Filminstallation in der White Cube Gallery London schuf Richter die Klanginstallation The Anthropocine.

Redaktionelle Mitarbeit Benita Ortwein und Katrin Tetzlaff
Lesen Sie auch:
„Neue Macken“ – Die Kunstakademie Düsseldorf wird zum Drehort des Richter-Films „Werk ohne Autor“
Rolli und Gerd | Akte der doppelten Negation – Wie Gerhard Richters „Schwestern“ ins Kunstmuseum Bonn fanden
Das Glück dieser Tage steckt untertage – Ein unbekanntes Gemeinschaftswerk von Isa Genzken und Gerhard Richter
Alles Pappe – oder wie eine Ausstellung zum „Kapitalistischen Realismus“ ohne Kunst auskommt