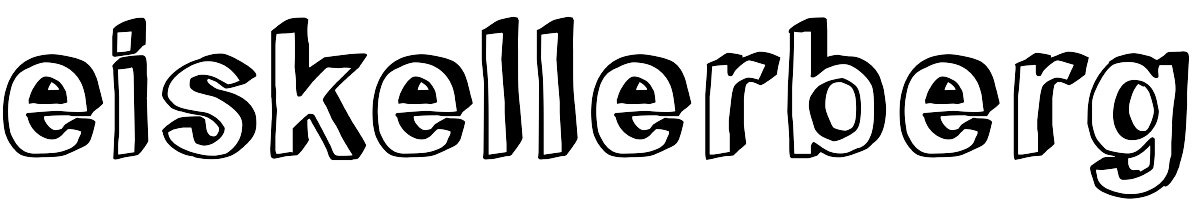Im Frühjahr 1921 schrieb Jean Louis Vaudoyer in l’Opinon, einer damals angesehenen Pariser Wochenzeitung (die in diesem Jahr als Tageszeitung neu aufgelegt wurde), über eine Ausstellung niederländischer Malerei im Jeu de Paumein den Tuilerien. „Mysteriöser Vermeer“ lautete die Schlagzeile. Vaudoyers Studie sollte Marcel Proust in seiner schäbigen Zelle im fünften Stock der Rue Hamelin 44 erreichen. Die Lektüre berührt den einsamen Schriftsteller mehr als alles, was er je von seinem Freund gelesen hat. Er schreibt ihm sofort einen Brief, der mit dem Hinweis auf seine Erschöpfung und die Unmöglichkeit endet, in seinem erbärmlichen Zustand die Ausstellung zu besuchen. Erst die beiden Fortsetzungen bewirken das Wunder, dass der kränkelnde Proust mit einer Regel bricht, die so alt ist wie seine Liebe zu Vermeer: Seit seinem zwanzigsten Lebensjahr pflegt er nach einer schlaflosen Nacht um acht Uhr morgens ins Bett zu gehen. Seit 12 Jahren hatte er seine Wohnung kaum noch verlassen.
„Longtemps, je me suis couché de bonne heure“, mit diesem Satz läßt er seinen Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit beginnen und niemand denkt heute daran, dass das Glück des Schriftstellers tagtäglich damit einsetzte, um acht Uhr morgens zu Bett zu gehen. Tatsächlich schickt Proust an diesem Morgen seinen Diener mit einer schriftlichen Bitte zu Vaudoyer: “Lieber Freund, ich bin nicht zu Bett gegangen, um heute morgen Ver Meer und Ingres zu sehen. Wollen Sie den Toten, der ich bin und der sich auf ihren Arm stürzen wird, dorthin geleiten? (…) Wenn Sie zusagen, werde ich Sie gegen viertel nach neun Uhr abholen lassen.“
Noch fünf Monate sollten ihm bleiben, als er im Juni 1922 ein letztes Mal an seinen „sehr lieben Freund“ schreibt, um sich zu bedanken: „Ich bewahre die leuchtende Erinnerung an den einzigen Morgen, den ich wiedersah und an dem Sie meine Schritte so liebevoll lenkten, die zu sehr schwankten in Richtung auf jenen Ver Meer mit den Giebeln der Häuser `die wie kostbare chinesische Objekte sind´“.
Noch vor dem Dankesschreiben hatte Proust seine leuchtende Erinnerung an den Besuch der Ausstellung in einer filmreifen Szene in den fünften Teil seines Romans (La Prisonnière, Die Gefangene) einmontiert. Geschildert wird der dramatische Tod Bergottes. Weil „ein Kritiker geschrieben hatte, dass Vermeers Ansicht von Deflt (…), ein Bild, das er sehr liebte und sehr gut zu kennen meinte, ein kleines gelbes Mauerstück (an das er sich nicht erinnerte) enthalte, dass es für sich allein betrachtet einem kostbaren chinesischen Kunstwerk gleichkomme, von einer Schönheit, die sich selbst genüge…“, begibt sich Bergotte ins Museum, prompt trifft ihn der Schlag genau vor diesem, Prousts´ Lieblingsbild: „Er rollte vom Sofa auf den Boden, wo die hinzueilenden Besucher und Aufseher ihn umstanden. Er war tot. Tot für immer?“
Die Kunst des Zusammenstellens und des Zusammenfügens, das „composer“, die eigentliche Methode Prousts, wird hier anschaulich. In der Beschreibung der Ansicht von Delft übernimmt Bergotte/Proust wesentliche Elemente aus Vaudoyers Essay, den „rosagoldenen Sand“, die „Frau mit der blauen Schürze“ im Vordergrund, die keramikartige Perfektion jedes Details in den Ziegelmauern der Stadt. Bis in Einzelheiten hinein findet sich alles in den Roman übertragen: Maler und Bild, Zeit und Ort der Ausstellung, der Anlaß des Besuches und seine Umstände; nur dieses eine Detail nicht. Bei Vaudoyer kommt jenes „petit pan de mur jaune avec un auvent“ gar nicht vor. Doch warum unterstellt Proust dem Kritiker dann, es gesehen und derart gelobt zu haben? Es ist ein unscheinbares, leicht zu übersehendes Detail, das hier den Ausblick über das Ende hinaus bietet: Ein kleines Stück Unsterblichkeit, das dem (nahen) Tod abgerungen ist, „von einer Schönheit, die sich selbst genüge…“ und keinesfalls von „der Dürre und Nutzlosigkeit einer so erkünstelten Kunst…“
Proust kapriziert sich nicht auf die „chinesischen Kostbarkeiten“, auf die Vaudoyer anspielt. Mit der Bewunderung jenes unscheinbaren Mauerstücks zeigt er sich Vermeer wie auch der modernen Ästhetik mehr verpflichtet als dem Ästhetizismus seiner Zeitgenossen. Ausgerechnet Proust! Ausgerechnet seine Sehnsucht nach dem Unscheinbaren, beinahe Übersehenen weckt die Empfänglichkeit des Schriftstellers und macht ihn für ein Mauerstück empfänglich. Oder ist es gerade umgekehrt? Hat seine frühe Liebe für Vermeer ihn erst für ganz bescheidene Sinneseindrücke, beispielsweise von blühendem Weißdorn, drei Kirchtürmen im Abendlicht oder vom feucht-modrigen Geruch in einem Klosetthäuschen, angeregt. Während Proust nächtens also componiert und collagiert und sein alter ego in einer hinreißend dramatischen Romanszene sterben lässt, zeigt Vermeer in aller Schlichtheit und Selbstverständlichkeit eine Ansicht seiner Geburtsstadt, die sich selbst genügt. Kleines gelbes Mauerstück – nutzlose, erkünstelte Kunst: dazwischen liegt der tiefe Selbstzweifel, der Abgrund des Schriftstellers Prousts wie der Kunst überhaupt. Seine Erfassung (Erfindung) des Mauerstücks öffnet Vermeers Bildwelt immerhin für die Moderne, zu Van Gogh, zu Picasso, bis weit in die Pop Art eines Andy Warhol oder Gerhard Richter.
„Tod für immer?“ Vom Maler wissen wir, daß er dem Bleizinngelb groben Quarzsand beimischte, um die Korngröße der Pigmente und die Körperhaftigkeit der Textur zu verstärken. Bergotte, der Schriftsteller, heftete nur einen kurzen letzten Blick „wie ein Kind auf einen gelben Schmetterling“ auf die „kostbare Materie“, schon hört man ihn bekennen: „So hätte ich schreiben sollen, wie dieses kleine gelbe Mauerstück es ist.“ Es liegt darin viel von der Vergeblichkeit, schreibend die Unsterblichkeit zu erreichen. Vielleicht gelingt es Malern wie Vermeer einfach besser als Schriftstellern. Ut pictura poesis.
Es ist Vaudoyer, der in Bezug auf Vermeer den Begriff der „inneren Poesie“ findet. Und weiter liefert er Proust das Stichwort für die Demut des Schriftstellers vor der Malerei: „Gerade jetzt, da wir von Vermeer van Deft sprechen, verspüren wir stärker als je zuvor die Nichtigkeit des Versuchs, den Eindruck und die Ergriffenheit, die uns das Schauspiel eines Kunstwerks verschaffen, in Worte fassen zu wollen.“ Um ihn dann doch nicht zu unterlassen: „Bei Vermeer sind Thema und Ausdruck eins. Er ist der Typus des Malers schlechthin; die Macht, die von seinen Bildern ausgeht, erwächst einzig und allein aus der Art, in der die Farbe angeordnet, behandelt und verarbeitet ist.“
Die Briefleserin in Blau war nicht mit in die Pariser Ausstellung gekommen. Und doch erweist sich das Bild als vielleicht bester Beweis für Vaudoyers Vermutung, trägt das Bild doch eine Farbe im Titel: Blau.
II
Wirklich ist das Bild, eine Interieurszene, ganz erfüllt von diesem Blau. Noch einmal Vaudoyer: „Das Wort ´Szene´ suggeriert eine Aktion, bis auf wenige Ausnahmen kann man jedoch sagen, daß sich in Vermeers Bildern nichts ereignet. Und doch vielleicht liegt einer der Gründe ihrer blendenden Wirkung auf uns in dem Kontrast zwischen dem unbeweglichen, stillen Leben der Menschen in Interieurs, die so ruhig und klar wie Spiegel sind, und dieser Tyrannei der Farben, die auf ihnen lastet, von denen sie beherrscht, gebannt, bezwungen scheinen“.
Nichts davon hier. Auf der Briefleserin lastet keine Farbe, sie wird von dem Blau auch nicht beherrscht oder gebannt, noch gar bezwungen. Vielmehr läßt der Maler das Morgenlicht auf der blauen Jacke, die die junge Frau über einem weiten Rock trägt, in unendlich vielen Blautönen spielen, vom hellsten zum tiefsten und dunkelsten Blau. Als käme es ihm allein auf dieses Spiel des Lichts an, das von links durch ein Fenster, das wir nicht sehen, in den Raum fällt, hat er das so vertraute wie geheimnisvoll schimmernde Blau gewählt. Sonst keine Farben, nur Ocker ringsum, ein wenig Weiß dazu. Nichts zielt auf Kontrast, Dominanz oder Tyrannei. Die Stille in der Kammer wird von dem Blau getragen, gesteigert, wie es von der jungen Frau in den Raum ausstrahlt.
Es ist die Morgenjacke, die die Frau mit breiten Schlaufen über ihrem Bauch, wie an den Ärmeln gebunden hält, die dieses Blau trägt. Sie wird mit Färberwaid, Isatis tinctoria, einer Pflanze, die bereits seit vielen Jahrhunderten in Europa kultiviert wurde, eingefärbt sein. Oder etwa mit Indigo, einer Färberpflanze, ursprünglich aus einem Tal des Indus stammend, die seit 1500 über Goa per Handelsschiff in die Häfen Europas gelangte. Es sind die einfachen Farben für alle möglichen blauen Kleidungsstücke, von den Jacken der Fischer und Seeleute bis zur Hausjacke einer Bürgersfrau, gewöhnlich, alltäglich.
Für das Blau der Jacke in seinem Bild verwendet Vermeer jedoch Ultramarin, das teuerste Pigment überhaupt. Die alte italienische Bezeichnung, Oltramarino, sagt es, „über das Meer“. Das Blaupigment wird aus fein gemahlenem Lapislazuli gewonnen, einem methaphorischen Gestein, das ausschließlich in Minen im Norden Afghanistans im westlichen Hindukusch, in der Provinz Badachschan gewonnen werden konnte. Auch dieses Gut kam mit den Fleuten und Pinas über das weite Meer in die holländischen Häfen. Aber es war teuer wie Gold und entsprechend kostbar. Vermeer legt dieses Fra Angelico Blau auf einen kupfergrünen Untergrund, um die Strahlkraft zu erhöhen. Seit der Renaissance war Blau der Jungfrau, der Gottesmutter vorbehalten. Ein doppelte Erhöhung und Aufwertung. Und doch geht es Vermeer nicht um eine Zurschaustellung von Kostbarkeiten und Preziosen aus den Schatzkammern des Welthandels. Er will kein kostbares Blau zeigen, sondern das Einfache kostbar.
Eine beiläufige Szene wird zu einer eigenen „Macht“, die „einzig und allein aus der Art, in der die Farbe angeordnet, behandelt und verarbeitet ist“? In keinem anderen von Vermeers Bildern gewinnt das Blau jedenfalls eine derart raumgreifende, beunruhigende, ja magische Wirkung wie in der Briefleserin in Blau. Nicht in dem früheren Gemälde Das Milchmädchen um 1660, nicht in dem im gleichen Jahr entstandenen Frau mit Waage, nicht in der Kopfstudie Mädchen mit dem Perlenohrring, 1665-1667, auch nicht im späten Junge Frau am Spinett um 1670/72.
Und doch handelt es sich, bei aller Farbmagie nicht um ein abstraktes Gemälde und auch nicht um einen Spiegel, so ruhig und klar, wie Vaudoyer vermutet.
III
Nicht ganz. Das Bild ist nicht nur Farbe, es gibt eine Szene wider. Die ist denkbar einfach und überschaubar: Eine junge Frau steht, leicht aus der Mitte gerückt, in einer Kammer mit dem Gesicht zum Fenster, durch das Sonnenlicht in den Raum tritt. Sie hat einen Brief in beide Hände genommen, um ihn zu lesen. Niemand sonst befindet sich im Raum. Ein Tisch, zwei leere Stühle, an der Wand eine Landkarte, alles nur angeschnitten gezeigt. Auch die zentrale Figur selbst. Nur den Brief sehen wir ganz und selbst ihn auch wieder nur geteilt. Eine Seite liegt beiseite auf dem Tisch, die andere hält die Lesende in Händen.
So ist alles auf die Frau und den Brief bezogen. Das Lesen bedarf der Stille, einer ungestörten Aufmerksamkeit. Nun war es um 1663 keineswegs alltäglich, einen Brief zu empfangen, noch daß eine Frau überhaupt zu Lesen imstande war. So liegt eine gewisse Spannung in der intimen Tätigkeit selbst, die uns vor Augen geführt wird. Die Empfängerin hält den Brief so mit beiden Händen vor ihre Brust, daß sie die handschriftlich zu Papier gebrachten Worte gut zu lesen vermag. Denn es wird ihr wichtig sein, den Inhalt der vertraulichen Botschaft recht zu verstehen. Der Maler lässt uns der Frau im Bild dabei zusehen, wie sie liest, die Worte entziffert und deren Bedeutung gewahr wird. Und wir sie in dieser Stille und Aufmerksamkeit ja nicht stören wollen.
Das Licht fällt gerade auf ihr Gesicht, daß wir im Profil sehen, der Mund ist leicht geöffnet, die Augen hinunter auf den Briefbogen gerichtet. Ihr Augenmerk ist auf den Brief gerichtet. Darin liegt ihre Gunst, ihr Glück. Es liegt ihr Glück in diesem Augenblick voller Aufmerksamkeit für eine besondere Tätigkeit, das Lesen. Wie es vielleicht auch in der Botschaft, die der Brief mit sich bringt, verborgen liegt. Glück und Gunst sind verwandte Worte. Die Gunst des Schicksals, seine Güte ist immer ein Geschenk der Fortuna. Und das haben wir nicht in Händen. Aber was hält der Brief für die Leserin bereit? Es wird sich ihr Zeile um Zeile mitteilen. Der Absender hat es ihr allein anvertraut.
Die große Landkarte an der Wand im Hintergrund läßt es erahnen, es sind bewegte Zeiten, damals in den Niederlanden. Um 1650 hatte das niederländische Handelsimperium seine größte Ausdehnung erfahren, als etwa die Hälfte des Welthandels von den Sieben Vereinigten Provinzen umgeschlagen wurde. Einmal zur weltumspannenden See- und Handelsmacht aufgestiegen, sah sich die Republik der Sieben Vereinigten Niederlande gefordert, ihre Vormachtstellung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gegen England und Frankreich immer wieder zu verteidigen. Das später so genannte Gouden Eeuw (Goldene Zeitalter) war ein prekärer Zustand. Wer auch immer der Briefeschreiber war, Handelsherr, Kapitän zur See oder Soldat im Feld, er wird für Monate, oft Jahre von zu Hause fort gewesen sein. Sein Schicksal, wie das seines Landes hing vielfach vom Kriegsglück ab. Und abenteuerlich waren die Erlebnisse draußen auf den Meeren der Welt allemal. Die Landkarte in der Kammer zeigt ausschnitthaft ein Stück Land zwischen den fernen Küsten.
Mit den Schiffen der Verenigde Oost-Indische Companie kam bald auch chinesisches Porzellan in großen Mengen nach Europa. Das forderte gleich mehrere Städte in den Niederlanden heraus, in denen sich die Herstellung von Keramik bereits zu einer heimischen Industrie entwickelt hatte. Zuerst in Delft gelang es, die exotische Ware zu imitieren. Zinnlasierte Keramik in chinesischer Form und Ornamentik konnte die Importware tatsächlich verdrängen. Die Nachfrage nach dem billigerem „holländischen Porzellan“ stieg und wurde wieder zu einem wichtigen Pfeiler der lokalen Wirtschaft. 31 Manufakturen produzierten um 1675, dem Todesjahr Jan Vermeers, mehrere Millionen Stücke pro Jahr, um Delfts aardewerk in alle Welt zu exportieren.
Hat sie lange auf Nachricht gewartet? Umso kostbarer, bedeutender wird ihr der Brief sein. Doch verraten die Züge der Briefleserin weder Furcht, noch Entzücken, kein wie auch immer zu deutendes Lächeln zeigt sich, noch ein Erstarren vor einer Schreckensnachricht. Die Frau liest den Bericht gefasst und gesammelt. Erst will sie bis zu Ende lesen, in stiller Erwartung, was es denn da zu erfahren gibt. Es sind vielleicht die Zeilen ihres geliebten Gemahls aus Übersee, die erste Nachricht nach langem. In der Haltung gebannter Erwartung sehen wir die Briefleserin in der Kammer stehen, den so sehnlich erwarteten Brief lesend, eine Weile des Innehaltens und des wachen Dazwischen. Wie auch der leicht gewölbte Bauch der Briefleserin andeuten mag, sie sei guter Hoffnung. Es wäre ein doppeltes Empfangen. Die junge Frau dort, die den Brief empfangen hat, ist in Erwartung eines Kindes. Wir aber auf der anderen Seite des Bildes erinnern uns vielleicht, die wir das Leben lang in Erwartung des Todes sind.
IV
Auch wird man das Lesen eines Briefes nicht ohne weiteres als eine Tätigkeit bezeichnen. Wir sehen die Frau aufrecht und still im Raum stehen. Diese Leserin sitzt oder liegt nicht entspannt auf einem bequemen Möbel. So ist das Lesen, wie es sich im Bild zentral zeigt, nicht als eine Tätigkeit oder Handlung dargestellt, aber auch nicht als Untätigkeit oder kurzweilige Beschäftigung. Es ist keine alltägliche Handlung, keine spontane oder flüchtige Bewegung erfasst, schon gar keine herausragende oder heldenhafte Tat. Es liegt eher zwischen den Dingen, zwischen Tätigkeit und Verharren. Wie ja das Lesen eines Briefes selbst einer gesteigerten Aufmerksamkeit bedarf, einer Sammlung der Sinne, die von außen kaum zu bemerken ist. In diesem Interieur, in dem alles nach Innen gerichtet scheint, alles Wesentliche sich im Kopf der Lesenden abspielt, dringt das Außen durch das Sonnenlicht, die Landkarte und den Brief ein. In die Enge und Ordnung der Kammer, vielleicht auch in die Angst der Frau vor schlechter Nachricht, mischt sich freundliches Tageslicht und ein Brief aus der Ferne. Stille und Weite fließen ineinander. Die Unermesslichkeit der Stille antwortet die unermessliche Spannung des Geistes.
Das Lesen als eine intellektuelle Leistung sehen wir hier mit dem Herzen der Frau, mit ihrem Bangen und vielleicht auch ihrer Sehnsucht verbunden. Ist sie dem Absender in Liebe verbunden, wird ihr Geist sich immer tiefer mit dem Geschriebenen verbinden. In diesem Zustand herrscht vollkommener Frieden – nicht Zufriedenheit. Eher ein verletzlicher Friede, der gleichwohl Ordnung Schönheit und Kraft ausstrahlt.
Es ist diese Ungewissheit und Unbestimmtheit, aus der sich der Reiz des Bildes gewinnt. Alles im Bild ist überschaubar, klar und deutlich gezeigt. Doch wiederum nur im Ausschnitt, ohne Grenzen und ohne Mitte. Auch findet sich kein Hinweis, was die Frau da erfährt, wir werden im Unklaren gelassen, was der Brief mit sich bringt. So bleiben wir im Ungewissen. Nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, Stille und Schönheit, die sich nicht in Worte fassen lassen, hat Vermeer in seiner Innenansicht versammelt. Sie zeigt uns eine Lesende und doch das Wesentliche durch Worte nicht zu erfassen. „So hätte ich schreiben sollen“, fährt es Bergotte jäh durch den Kopf.
Sein ganzes Leben malt Vermeer nur in einer Stadt, sogar nur in einem Viertel, ja nur in einem Haus. Es sind fünf Frauen, für die vielleicht eine einzige Modell gestanden hat. Seine Kunst der Reduktion sucht eine Antwort auf die vitalen und mannigfaltigen Allegorien des Besitzes der niederländischen Gemäldeproduktion seiner Zeit. Wohlstand und Besitzerstolz, bekräftigt in den Darstellungen der Städte, Kirchen und Wohnhäuser, in den hochgetürmten Stillleben, in der exotischen Pracht der aufgetischten Früchte und Speisen, in der Reinlichkeit und Sittsamkeit der Stuben, in der Ausstaffierung der Herrschaften, sichtbar in den Weiten des Landes und dem wohlgenährtem Vieh, wie den ausziehenden und heimkehrenden Schiffen. Nichts von alledem bei Vermeer. Keine Pracht, keine Festlichkeit, überhaupt kein Besitzerstolz. Wie ein Widerspruch die Briefleserin in ihrer Kammer. Keine Statusdinge, keine Handlung, keine Allegorie, keine gemeine Moral, keine höhere Religion und keine Farben. Selbst dem Blau sieht man nicht an, daß es aus Lapislazuli gewonnen ist. Aber geht es Vermeer um eine Rückführung des Komplizierten auf etwas Einfaches? Seine Kritik an der überschwänglichen Zeit? Innere Poesie gegen erkünstelte Kunst? Jan Vermeer erscheint hier wie der Antipode zum flämischen Barock des großen Peter-Paul Rubens. So bildet das kleine Gemälde einen gewissen Kontrapunkt inmitten der Prachtstücke der Münchner Holländer.
Vermeers immer wieder verblüffende Wirkung verdankt sich der Einfachheit, darin tief mit dem Volkscharakter der Niederländer (Johan Huizinga) verbunden. Er zeigt uns diese Dinge als Schönheit und in großer Würde. So findet sich seine Liebe zur Wirklichkeit, seine Hinwendung zu den Dingen des gewöhnlichen Lebens hier in der gesteigerten Aufmerksamkeit des Lesens des nichtstofflichen Briefes aufgehoben. Seiner Vorliebe für alles Schlichte, Einfache und Wesentliche entspricht ein Minimalismus der Farbe. Doch wird alle Wirklichkeit als ein Dazwischen, ein transitorisches Verbleiben und Vorübergehen aufgefasst. Das alltägliche Blau, irdisch wie eine Hausjacke wird sphärisch, unendlich.
V
Im Alter von neun Jahren habe ich das kleine Bild der Briefleserin vermutlich zum ersten Mal gesehen als meine Eltern einen Abstecher von der nordholländischen Küste nach Amsterdam unternahmen. Seitdem bin ich viele Male dort gewesen und immer habe ich mich über das so blasse, so strahlende Blau des Bildes gewundert. An Details aber konnte ich mich kaum je erinnern.
Habe ich etwas übersehen? Einen Fleck vielleicht, der das Geheimnis Vermeer doch zu lüften vermag? Oder ist nicht bereits alles gesagt? Auch alles über Vermeers holländischen Wirklichkeitssinn und seine bezwingende Farbensinnlichkeit? So reiste ich an einem hellen Sommertag nach München als ich erfuhr, das Bild sei dort als Leihgabe des Amsterdamer Rijksmuseum für eine Weile ausgestellt. Wie beschwerlich auch immer der Aufstieg durch dieses, wie ein gewaltiges Tal sich öffnendes Treppenhaus ist, ich verschmähte auch dieses Mal den Aufzug, um in die oberen Säle emporzusteigen. Wie schön das Oberlicht hier die Gemälde bald anlächelte.
Die blinden, von Schlieren und Verfärbungen entstellten Fenster und Dachverglasungen über den Oberlichtsälen hatte man endlich ersetzt, 1400 wie ich hörte. Die Briefleserin in Blau liess sich in schönstem natürlichem Licht sehen. Da ich um die Morgenstunde dort war, mochte das Licht, das durch die Oberlichtdecke fiel, mit dem Licht, das durch das Fenster in der Kammer auf die Briefleserin fällt, korrespondieren. Und da stand ich nun. Mein Atem ging vom Treppensteigen (und vielleicht vor Erregung) noch etwas heftig als ich gewahr wurde, wie mein Gegenüber da in der Zurückgezogenheit ihrer Delfter Kammer ihren Atem vor gespannter Aufmerksamkeit und Hingabe an ihr Lesen ruhig gestellt hatte. Sie stand da in den Brief vertieft und ihr Atem war unwillkürlich leicht geworden. Wie meiner bald beim Betrachten des kleinen Bildes. Eine malerische Suggestion über die Jahrhunderte hinweg. Hatte je ein Maler zuvor bedacht, die Stille zu malen, indem der Atem still wird?

Es gab keinen Zusammenbruch im Holländischen Saal; dafür brach eine stille Freude aus, mal Dankbarkeit und Demut, mal Delirium. Keine Bank zum Sitzen. So stieg ich langsam wieder die Treppe hinunter. Das unbetitelte Bild, das Vermeer uns hinterlassen hat, ist sein unbuntestes Bild, abgesehen von dem Blau. Blau ist die freudige Erwartung.
Bis 30. September im Holländersaal IX
Der Eintritt beträgt sieben Euro (ermäßigt fünf Euro)
Lesen Sie auch:
Vermeer in voller Größe
Die Tefaf treibt es zu neuen Ufern