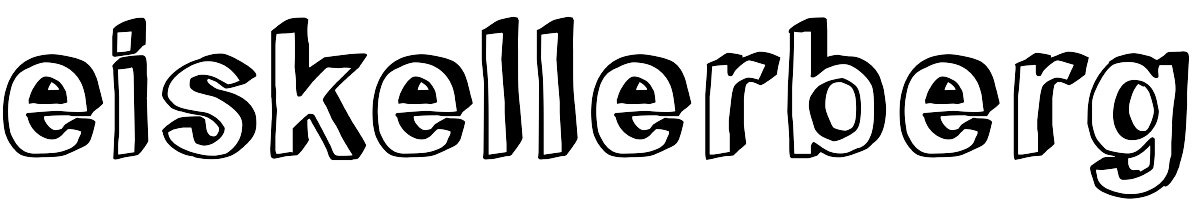Wie hätte es auch anders kommen können! Aber dann stand man doch etwas sehr verblüfft im großzügig bemessenen Padiglione Italia in den Arsenale: Die Gleichschaltung italienischer Gegenwartskunst unter der Patronage Silvio Berlusconis war unübersehbar in der bunten Welt der 53. Biennale di Venezia angekommen.
Wer Anderes erwartet hatte, musste sich angesichts der hier aufgebotenen glitzernden und gefälligen Kunstproduktion eingestehen, das Prinzip Berlusconi unterschätzt zu haben. Überraschend höchstens, wie unverholen hier Berlusconikunst aufgefahren wird. Längst hat sich die schrille Unterhaltungsästhetik des italienischen Fernsehens als stilbildend für die italienische Gegenwartskunst hochgearbeitet, oder vielmehr diese auf ihr Niveau heruntergeschraubt. Die Sehgewohnheiten der alten Kulturnation werden seit ein paar Jahrzehnten schließlich auf Berlusconis TV-Kanälen trainiert.
“Dieser italienische Pavillon hätte auch Berlusconi gefallen”, frohlockte der römische Kulturminister Sandro Bondi bei seinem Rundgang über die Biennale. Wohl wahr. Gleich Eingangs schwingt eine Reihe Showgirls ihre wohlgeformten Beine. Man darf ihnen unter die Röcke blicken. Gian Marco Montesano hat die Schönheiten nur von den Stöckelschuhen bis zum Bauchnabel gepinselt. Der Rest interessiert offenbar nicht. Gegenüber wartet eine Bühne voller Mikrophone auf den Beginn der Show. Bühne und Mikros sind über und über mit Strass-Steinen besetzt. Beatrice Buscarloi und Luca Beatrice sind die Kuratoren.
Kia Vahland hat in der Süddeutschen Zeitung einen bemerkenswerten Beitrag über das Geschlechterverständnis der Ära Berlusconi veröffentlicht. “So verrohen die Manieren und es verroht auch das Selbstverständnis der Kulturnation. Der italienische Pavillon der Kunstbiennale ist ein erstes Warnzeichen – vor zwei Jahren war hier noch eine medienkritische Arbeit von Francesco Vezzolis zu erleben. Werden 2011 in Venedig die blankgeputzten Bronzen nackter Frauen ausgestellt, die man jetzt zwischen den lebendigen Bikinimädchen auf den Paparazzo-Fotos aus El Pais von Berlusconis Villa in Sardinen sieht?” (Brave Bikinimädchen, SZ v. 9. Juni 2009. Gustav Seibt setzt sich dazu mit dem “Körper des Staatsmannes auseinander und fragt, “Wovon Berlusconis Bikini-Bildchen ablenken”?, SZ v. 8. Juni 2009)
Was Vahland nicht fragt: Wie hat eigentlich der künstlerische Leiter der Biennale, Daniel Birnbaum, diese Italo-Show hinnehmen können? Von einen Protest des stets gut gelaunten Birnbaum erfuhren wir jedenfalls nichts.
Es gibt Kunst, die einsam macht, einfach weil sie grottenschlecht ist. Da steht man mitten in der Heerschar der unentwegten Kunstpilger und fühlt sich vom Kopf zu den Füßen vereinsamen. Gäbe es ein sprachliches Äquivalent zu schockgefrieren, es müsste schockvereinsamen lauten. Sicher, auf jeder Biennale gibt es Tiefschläge, Abgründe an miserabler Kunst tun sich auf. Nahe dran sind Miwa Yanagis Monsterfrauen im Japanischen und Claude Léveques Käfig “le grand soir” im Französischen Pavillon.
Küche, Katze, Kauderwelsch
Und der Deutsche? “Es wird eine sprechende Katze geben”, verspricht Liam Gillick (der 1964 im britischen Aylesbury geborene, heute in London und New York ansässige Künstler) im Katalog des Deutschen Pavillons auf der 53. Biennale di Venezia (7. Juni bis 22. November). Selbst auf dem Cover der ungewöhnlich bescheidenen Broschüre heißt es kurz, aber verlockend: “Eine Küchenkatze spricht”. – Was hätte sie uns zu sagen? Statt dessen weist der Künstler sphinxengleich das Rätsel zurück an die Fragenden: “Wie würden sie sich verhalten?”
Im Pavillon selbst, ganz hinten rechts auf dem traditionellen Ausstellungsgelände, den Giardini, hockt tatsächlich eine ausgestopfte Katze auf einem nüchternen Schrankmöbel (helle Kiefer) und blickt von oben herab auf die Besucherschar. Sie spricht aber nicht. Zwar haben die Techniker ihr einen beweglichen Unterkiefer eingebaut, doch der funktioniert nicht. In der Ausstellung hält sie ein Stück bedrucktes Papier in der Schnauze – ein Pamphlet? eine Kunstzeitung? Dermaßen mundtot gemacht, hockt sie nur da und könnte, wenn sie nicht mausetot wäre, einer fremden Stimme lauschen, die unablässig und nervtötend aus den Lautsprechern schallt. Man kann die Worte nicht verstehen. Sie verhallen. Obwohl es sich just um jene Weisheiten handelt, die eigentlich die Katze hätte sprechen sollen. Auf Nachfrage lässt sich erfahren, dass es sich um einen der poetisch-kryptischen Texte des Künstlers selbst handelt. Den hat er der Katze seines Sohnes in die (geschlossene) Schnauze gelegt und liest ihn selbst laut vor. Es ist der Künstler, der hier durch die grau geströmte Hauskatze spricht: auf Englisch. Das Versprechen des Liam Gillicks erfüllt sich nicht. Die Katze spricht nicht, der Text bleibt unverständlich. Das war anders geplant. Doch als die Räume für die Besucher endlich freigegeben wurden, musste man feststellen, dass deren “Nebengeräusche” die Worte des Katzenkünstlers zu einem unverständlichen Klangteppich verhallen ließen. Sind die Räume erst menschenleer sind, könnte man den gesprochen Text auch deutlicher vernehmen. Künstlerpech? Dem technischen Mangel war nicht mehr abzuhelfen, die Sache mit der Katze geht auch so über die Venedig-Bühne.
Was ist davon zu halten, wenn ein gesprochener Text ein wesentlicher Bestandteil der Installation wird, dieser aber durch außerkünstlerische Umstände unverständlich bleibt? Da hilft es wenig, wenn man den Text später im Katalog nachlesen kann. “Wie würden sie sich verhalten?”, fragt der Künstler. Wir fragen: Was hat eigentlich der Kurator versäumt?
Es sind nicht allein technische Mängel, die die Arbeit Gillicks so spröde, entlegen und nichtssagend machen. Schon sein Einfall, die “Frankfurter Küche” der Margarete Schütte-Lihotzky aus den Zwanziger Jahren als Hauptmotiv für seine raumbezogene, alle drei Säle des Deutschen Pavillons durchziehende Arbeit zu nehmen, trägt nicht weit. Soll hier etwa die Kleinbürgermoderne gegen die Naziarchitektur in Stellung gebracht werden? Die Auseinandersetzung mit der vermeintlichen Nazi-Architektur des Deutschen Pavillons haben bekanntlich andere Künstler (Hans Haacke, Gerhard Merz) schon vor Jahren überzeugender geleistet. Gillicks Arbeit leistet da nichts Neues. Zudem eignet sich die Frankfurter Küche schlecht als aufrechtes Bollwerk gegen den Ungeist der Nazi-Propaganda. Auch hier hätte der Kurator, Nicolaus Schafhausen, seine überall aufdringlich erklärte Nähe zum Künstler nutzen sollen, um den Künstlerfreund von der lausigen Idee mit der Küche und der Küchenkatze abzubringen. Katze, Küche, Kauderwelsch.
Wie aktuelle Themen in einer Rauminstallation ans verwöhnte Publikum befördert werden, kann man schräg gegenüber in den benachbarten, erstmals vereinigten Skandinavischen Pavillons (Dänischer und Nordischer Pavillon) erfahren. Hier hat das in Berlin ansässige Künstlerduo Elmgreen &Dragset mit Beiträgen von weiteren 24 internationalen Künstlern und Designern zwei unterschiedliche Sammlervillen eingerichtet. “The Collectors” weist mit Augenzwinkern und den nötigen Biss auf aktuelle Themen hin: etwa auf den Zusammenhang zwischen Real Estate und Moderner Kunst, auf Luxusdesign und Hunger, auf die Abgründe der Wirtschaftskrise, auf Sammlerwahn, Schwulenkunst und Tod. Der Besucher wird von einem Mitarbeiter einer Maklerfirma formvollendet an der Haustür empfangen und mit entsprechend werbenden, aber holen Anpreisungen durch beide Villen geleitet. “For sale” steht unübersehbar vor dem Haus. Ein Schild, das sich heute wie ein Warnschild liest. Der Hausherr, ein hochmögender Kunstsammler, liegt mit dem Gesicht nach unten im eigenen Swimmingpool.
Es mag aus Deutscher Sicht als ein Trost aufgefasst werden, dass mit dem Goldenen Löwen für den besten Künstler Tobias Rehberger ausgezeichnet wurde. Eine überraschende Entscheidung. Sie wirft zudem die Frage auf, warum man nicht einem deutschen Künstler aus der Generation wie Rehberger den Deutschen Pavillon anvertraute? Seine Cafeteria im Hauptpavillon ist zwar ein spiegelndes Glanzstück, aber keineswegs eine Meisterleistung. Allemal aber besser, als Gillicks spröde Holzeinbauten. Die mit Abstand beste Arbeit eines Deutschen Künstlers stammt von Hans-Peter Feldmann. Der Düsseldorfer Altmeister zeigt ein raumfüllendes Ensemble: ein Feldmann-Sammelsurium, Schneebesen, Lesebrille, Küchensieb, aufgebaut auf einem endlos langem Tisch, das im Lichte kreist und sich dreht, und dabei die wunderlichsten Schatten an die Wand wirft. Hinreißend. Ging der Goldene Löwe auch glatt an ihn vorbei, sollte man Hans-Peter Feldmann endlich den Deutschen Pavillon geben. Unsere Hoffnung für 2011!
Der Preis für Rehberger kann als Antwort der Städelschule auf den Einfall der YBA (Young British Artists) in den Deutschen Pavillon gewertet werden. Wie Gillick ist auch der zwei Jahre jüngere Rehberger Konzeptkünstler. Seine Installation für Venedig „Was du liebst, bringt dich auch zum Weinen“ ist wie die von Gillick zwischen Kunst und Design angesiedelt. Den Goldenen Löwen bekam Rehberger, Gillick blieb auf der grauen Katze sitzen. Der Wink mit der Frankfurter Küche stieß auf wenig Gegenliebe. Rehberger hat es vom Studenten an der Frankfurter Städelschule (bei Thomas Bayrle und Martin Kippenberger) zum Professor für Bildhauerei und stellvertretender Birnbaums gebracht. Birnbaum hat auch Rehbergers Lehrer und Ex-Kollegen Bayrle auffällig viel Platz in den Arsenale eingeräumt. Der Titel der aktuelle Publikation der Städelschule könnte die Lage nicht besser fassen: “Der Pavillon. Lust und Polemik in der Architektur”.
Das Zentrum der Biennale hat sich aus den Giardini herausverlagert auf das weitläufige Terrain der Arsenale und der Erweiterung in die den Arsenale Novissimo, wo u.a. die Vereinigten Arabischen Emirate erstmals gemeinsam mit einer aufwendigen, eher dem Tourismus, denn der Kunst gewidmeten Schau (ADACH, kuratiert von Catherine David) auftraten. Von den über die Stadt verteilten Ausstellungen nationaler Vertreter überzeugen vor allem der Neuseeländische Pavillon in der Rundkirche St. Maddalena von Judy Millar und neue, wandfüllende Malerei vom argentinischen Altmeister Luis Felipe Noé im Obergeschoß der Buchhandlung Libreria Mondadori unweit vom Markusplatz.
Zwei Ausstellungen in der Stadt vermochten zu zeigen, wie entkräftet das Programm der Kunstbiennale durchweg ist.
Im Palazzo Fortuny zeigt der Doyen der Antwerpener Kunsthändler Axel Vervoordt in aller Großzügigkeit und Gelassenheit, was die alte Wundertüte Europa so alles zu bieten hat. Diesmal öffnet Vervoordt keine Wunderkammer. Eher eine Promenade über die vier Geschosse des alten Palazzo soll es sein. Der Speicher des Gebäudes ist erstmals einbezogen und bietet einen der hinreißendsten Rundumblicke über die Dächer des alten Venedig. “In-finitum” nähert sich dem romantischen Gedanken des Fragments, des Undefinierten und Unfertigen. Eine faszinierende Schau, die als ein Kontrapunkt zum allzu gegenwartssüchtigen Geschehen in den Giardini erlebt werden kann. Allerdings fragt sich, warum Vervoordt nach seiner an gleicher Stelle gezeigten Ausstellung Artempo vor zwei Jahren, hier nochmals aufschlägt. Bei allem Suchen nach inhaltlichen Begründungen und philosophischer Unterfütterung, In-finitum bleibt doch ein zweiter Aufguss. Die Ausstellung bleibt weitgehend in einem schwelgerischen Blick nach rückwärts stecken. Nostalgie bis unter die Dachkante. Auch ein Axel Vervoordt kann sich nicht so einfach überbieten.
Gegen Brinbaums Faremondi (Weltenmachen) setzt Francois Pinauld “Mapping the Studio”. Auf dem schönsten Bauplatz, den es in Europa vielleicht noch gab, ließ der Französische Unternehmer und Sammler von Tadao Ando die Punta della Dogana zu einer Kunsthalle ausbauen. Hier und im Palazzo Grassi will Pinauld der Kunstwelt offenbar zeigen, wo der Hammer hängt. Thomas Schüttes greise “Efficiency Men” treffen auf Takashi Murakamis “My Lonesome Cowboy”, Otto Muehl auf Paul McCarthy, Sigmar Polke (erst auf der letzten Biennale vorgestellten Serie Axial Age) auf Mike Kelley. Der große Atem der globalen Kunstwelt durchzieht die weiten Hallen als sei Nichts weiter geschehen als ein kleines bisschen Krise. Kunst und Markt und Macht kreisen auf dem heiteren Karussell der Künste, als das Venedig schon so lange dient. Und draußen, ist ganz woanders.
C. F. Schröer