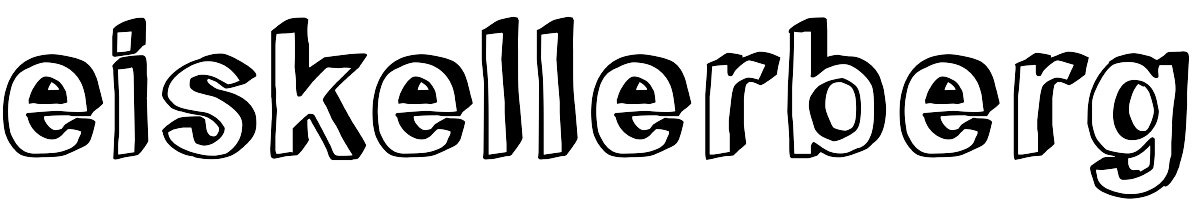~ Von Carl Friedrich Schröer, 18.03.2021 ~
Ein seltenes Buch. Ohne Titel (so der Titel). Auflage 200. Auf eigene Kosten und Gefahr im Selbstdruck herausgegeben (wegen zu erwartender Klagen, Verletzung der Persönlichkeitsrechte, Pipapo). 221 Seiten, Broschur. Ein Künstlerbuch? Eine Künstlerlegende? Eine Enthüllungsstory?
Es ist ein sehr persönliches Buch, doch beileibe keine „Geständnisse“. Huber beläßt es bei „Episoden und Begegnungen aus meinem Künstlerleben“.
Thomas Huber, der Maler, der Autor, auf dem Selbstfindungstrip? Das ist er schon seit seiner Geburt 1955 in Zürich, wie er freimütig gesteht. Aber wohin hat es ihn geführt? Warum jetzt diese Abrechnung? „Ich gehörte nicht dazu“, schreibt er, der Erfolgsverwöhnte, der dem eigenen Erfolg misstraut, ihn beargwöhnt.
Thomas Huber hat ein Buch geschrieben. Das ist wirklich nichts Neues. Das leistet uns dieser besondere Künstler immer wieder. Er malt schon immer Bilder und redet dann über sie. Malerei und Gerede sind bei ihm sozusagen ein Aufwasch. Er nennt es „Doppeltalent“. Doch hier geht er aufs Ganze. Jeder bekommt sein Fett weg. Besonders jede. Am Ende auch die Noppenfolie.

Die Kunstakademie Düsseldorf, wo er ab 1980 studiert „im Dämmerschlaf“. Fritz Schwegler „blieb zeitlebens ein Schwabe. Er war sparsam. Aber auch fleißig und produktiv.“ Seine Mitstudentin Katja Fritsch, „der Kunstmarkt ist ein Schlachtfeld.
Manchmal werden dort auch Schlachten wegen gescheiterter Liebe ausgefochten.“ Gabriele Henkel, die ihm seine ersten Bilder gleich beim „Rundgang“ abkaufte, brachte dem „adretten Jüngling“ mit dem Rolls-Royce Grünkohl in die Akademie. Die Liaison mit „der reifen Dame“ hielt auch nicht lange. Seine fast zwanzigjährige Ehe mit einer Mitstudentin streift er kurz. Vier Zeilen, sechs Kinder, eine „Villa mit einem großzügigen Parkgrundstück etwas außerhalb von Düsseldorf.“ Kommilitonen wie Thomas Schütte, Reinhard Mucha, Carl Emanuel Wolff, Bogomir Ecker kommen da besser weg. Andreas Gursky und Helge Achenbach weniger. Achenbach besuchte den Jungstar: „Wieviel brauchst Du im Monat?…Zwanzigtausend? Dreißigtausend? Du kannst auch mehr haben…Ich bekomme von dir, alles, was du produzierst, alles, verstehst du?“ Als Achenbach seine Hand auf sein Knie legt, wird es ihm mulmig. Huber lehnt dankend ab. Helge wendet ihm sein Gesicht zu. „Er hatte auf einmal einen brutalen Zug um den Mund. ´Spießer!´ zischte er mich an, Du bist ein elender Spießer.´“ Er gehört nicht dazu. Nicht zur „Goldküste“ in Zürich, nicht zu den „reichen Leuten“ in Düsseldorf und Umgebung, nicht zum Achenbach-Clan und auch nicht zu den neoexpressiven Malerstars. Und wahrlich nicht zu den Spießern untern Künstlern. Als er Udo Kittelmann einmal spüren lies, dass er das „Kleinbürgertum verachtete“, wars auch mit dieser Freundschaft vorbei.

Richtig lustig wird es, wenn Huber ins Erzählen kommt. Er kann das famos, unterhaltsam und immer bildhaft, immer auf eine verblüffende, paradoxe Pointe hinaus. Das liest sich leicht und ist ungemein erhellend obendrein. Sein feiner Sinn für Peinlichkeiten und Entgleisungen ist ausgeprägt, sein „Widerspruchsgeist“ ist hellwach, er findet sich auch in seinen abgründigen Bildern. Bei aller wohlproportionierten Ordnung und Aufgeräumtheit öffnen sich Abgründe, man kann sich leicht darin verlieren.
Bildermalen war zu jener Zeit, als Huber an die Akademie kam, verpönt. Also malte Huber große Bilder an der Staffelei und stellte sie in der Aula aus. „Ich wollte mein Bild nicht ausstellen, sondern vorstellen. Ich kündigte an, ich würde eine Rede davor halten. Die `Rede über die Sintflut´. „Bilder sind wie ein Unwetter, das über die Stadt hinweggeht. Es kommt, es dauert, und dann ist es wieder vorbei… Nach der Rede räumte ich das Bild und die Staffelei weg.“ Huber ist scheu, voller Hemmungen und liebt doch die Auftritte, die öffentlichen Vorträge. Aus Angst?
Er sieht die Gefahr, „dass das oft eigensinnige, scheinbar weltabgewandte und individuelle Kunstschaffen, das sich der gesellschaftspolitischen Tagesaktualität entzieht, nicht mehr wahrgenommen wird.“ Wieder nicht zugehörig. Er bricht der Kunst eine Lanze, auf dass sie „ihre sinnfreie Autonomie herausstellen könnte“ und weiß doch um die eigene Unzeitgemäßheit. Der Maler von der traurigen Gestalt, sitzt in seinem Berliner Wohnzimmer („Ich habe immer in Wohnungen gemalt“) und spielt genial mit der Malerei. „Ein Werk gelingt am besten spielend. Es war noch nie ein überzeugendes Argument für ein Werk, es habe viel Arbeit gekostet.“ Witz, Humor und Selbstironie ist da immer mit im Spiel. Am Ende resümiert er: „Ein geglücktes Werk ist das Zeugnis einer gelungenen Befreiung von sich selbst.“ Selbstbefreiung als künstlerischer Akt kann ein Dauerzustand werden oder ankommen bedeuten.
Ohne Titel, ohne Preis, ist ausschließlich über den Künstler selbst zu beziehen: mail@huberville.de