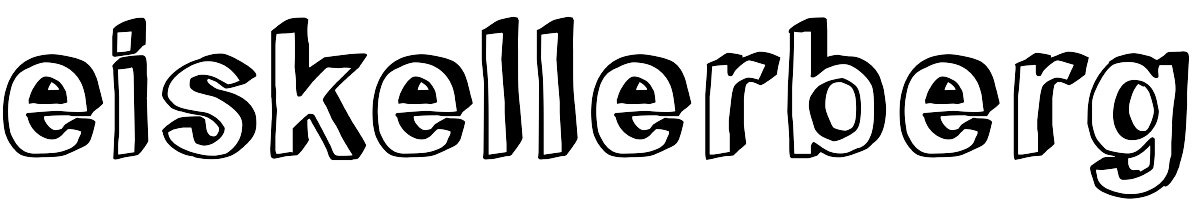Genesis, das 2013 erschienene Opus Magnum des im Mai in Paris verstorbenen Sebastião Salgado, zeigt die Schönheit von entlegenen Orten und den Reichtum unberührter Natur in beeindruckenden, ja überwältigenden Aufnahmen. Noch kein Fotograf vor ihm hat solche Szenen in Bilder gegossen.
„In Genesis sprach die Natur durch meine Kamera zu mir. Und ich durfte zuhören”, offenbarte der Fotograf nicht frei von Pathos und feierlicher Demut. Doch das Buch will mehr sein als eine Folge eindrucksvoller Bilder. Es ist Teil eines Projekts, das es sich zum Ziel gesetzt hat, „unser Bewusstsein dafür zu schärfen, wie kostbar die letzten unberührten Winkel unserer Welt sind – für uns selbst wie für zukünftige Generationen.“
In seiner Heimat, in Aimorés im Bundesstaat Minas Gerais wurde Salgado 1944 geboren, hier hat er zusammen mit seiner Frau Lélia Wanick Salgado das Instituto Terra gegründet – zur Aufforstung und Aufklärung über Natur und Umwelt. Die Organisation hat im Vale do Rio Doce inzwischen über drei Million Bäume gepflanzt hat, 2000 Quellen Instand gesetzt und die Rückkehr gefährdete Arten gefördert, um „eine vollständige Erholung der Nahrungskette und des Ökosystems zu erreichen.“
Im Rautenstrauch-Joest-Museum, dem ethnologischen Museum der Stadt Köln, ist nun die große Wanderausstellung „AMAZÔNIA – PHOTOGRAPHS BY SEBASTIÃO SALGADO“ zu sehen. Die Deutschlandpremiere versammelt 200 Schwarzweißfotografien, die sich ganz dem Amazonasgebiet und seiner Bevölkerung widmen – dem größten Regenwald der Erde, der sich über neun Staaten Südamerikas erstreckt. Salgado hat diese Bilder in einem Zeitraum von sieben Jahren fotografiert. 2021 erschien das Buch im Kölner Taschen Verlag. Kuratiert wurde die Schau von Lélia Wanick Salgado.

Brazil, 2019© SEBASTIÃO SALGADO
Die Fotostrecken werden durch einen Soundtrack des französischen Musikers Jean-Michel Jarre und Interviews mit indigenen Anführern und Anführerinnen aufgefrischt. Beim Betrachten der Landschaftsbilder und Porträts wird ihre Ohnmacht gegenüber der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen deutlich – die Sebastião Salgados Fotosessays beklagen.
Sein ganzes Leben als Fotograf war er ein Mahner, für die Natur, für ein humanes Miteinander, gegen Ausbeutung. Indigene Gemeinschaften des Amazonas (er dokumentierte den Alltag der Yanomami, der Asháninka, der Yawanawá, der Suruwahá, der Zo’é, der Kuikuro, der Waurá, der Kamayurá, der Korubo, der Marubo, der Awá und der Macuxi) sind für Salgado Hüter des Wissens und des Gleichgewichts.
Salgado wurde zu einer Ikone, weil er Fotojournalismus mit Zivilisationskritik auf einer neuen Stufe verband. Er wurde zu einem der besten Schwarzweißfotografen, der es wie kaum ein anderer verstand mit Schattierungen, Grauabstufungen und Hell-Dunkel-Kontrasten eine besondere Salgado-Ästhetik zu erschaffen, und hat er sich doch immer als „Sozialfotograf“ bezeichnet. Seine Werkgruppen wurden als politische Manifeste gewürdigt – und so ist auch sein AMAZÔNIA-Zyklus Beleg dafür, dass er es meisterlich verstand seine doppelte Mission zu verfolgen: „Licht auf Ungerechtigkeit zu werfen“ lautete seine Losung. So jedenfalls formuliert es Salgado 2019, als ihm in Frankfurt der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen wurde – das erste Mal ging der Preis an einen Fotografen.
1,8 Millionen Menschen haben die AMAZÔNIA-Ausstellung bereits weltweit gesehen, in Rom, London, São Paulo, Rio de Janeiro, Mailand, Zürich, Brüssel oder Madrid: Bilder, die faszinieren, zwischen Sanftheit und Ursprünglichkeit oszillieren, die aber Salgado zufolge auch ein ganz klares Ziel formulieren: Es gilt, das Bewusstsein für die Notwendigkeit zum Schutz des Ökosystems und der indigenen Einwohner zu schärfen: „Für mich ist dies die allerletzte Grenze, ein eigenes, geheimnisvolles Universum, in dem die ungeheure Kraft der Natur wie an keinem anderen Ort auf der Erde zu spüren ist. Dieser Wald erstreckt sich bis ins Unendliche und beherbergt ein Zehntel aller lebenden Pflanzen- und Tierarten – das größte Naturlaboratorium der Welt.“
Das Projekt ist als ein Appell an die Menschheit zu verstehen, sich ihrer Verantwortung für den Erhalt der Natur bewusst zu werden. Seine Fotos zeigen Völker und Landschaften, die vom verheerenden Ansturm moderner Gesellschaft und Entwicklung unberührt blieben. Es ist sicher auch Salgados Verdienst, dass wir heute das Amazonas-Gebiet nicht mehr nur als ein „grünes Paradies“ sehen. Es als ein riesiges und vitales Ökosystem verstehen, das ein Fünftel des gesamten Süßwassers der Welt und einen enormen Anteil an der globalen Kohlenstoffbindung bereitstellt. Auch wenn Jahr für Jahr weite Teile des Regenwaldes durch illegale Abholzung, Bergbau und Brandrodung verschwinden, hat uns Salgado die Augen geöffnet. Was als ein Bild unberührter Wildnis galt, wird zunehmend zu einer Metapher für die Zerstörung und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen.

Immer wieder wurde Salgado der Vorwurf gemacht, er schaffe romantisierende Bilder, die ein nostalgisches Ideal von Unschuld vermitteln. In Interviews stellte er klar, dass seine Bilder eine Einladung sind, sich mit den realen, oft dramatischen Folgen dieser Zerstörung auseinanderzusetzen. Doch bleibt die Frage, ob die Attraktion, die seine Fotografien auszeichnen, all das Leid und die Zerstörung wirklich einfangen.
Die Ethnologie hat darauf hingewiesen, dass solche auf Bildattraktivität angelegten Fotos Gefahr laufen, vermeintlich „authentische“ Kulturen und Lebensräume zu idealisieren. In seiner Arbeit hat Salgado wiederholt indigene Gemeinschaften fotografiert – und das oftmals in einem Stil, der an ethnologische Darstellungen erinnert, die „die Anderen“ als exotische, gleichsam mythische Figuren inszenieren. Dies führt zu einer nicht unproblematischen Wiederholung von historischen Mustern der „Exotisierung“ und „Primitivierung“, die bereits in den frühen ethnologischen Fotografien des 19. Jahrhunderts zu finden sind.
Der indische Theoretiker des Postkolonialismus Homi K. Bhabha spricht in diesem Zusammenhang von der „doppelten Vision“. Der westliche Blick habe sowohl Bewunderung für die dargestellten Menschen, verschiebe sie aber gleichzeitig in eine „andere“ und fremde Welt verschiebt, die den westlichen Normen nie gleichkommen kann.
Salgado schafft mit seinem Erzählen in Bildfolgen eine einfühlsame Nähe, aber eben auch eine Distanz zwischen dem Betrachter und den dargestellten Indigenen, dieser „anderen Welt“, die vom Fortschritt des Westens scheinbar unberührt geblieben ist. Vergleicht man AMAZÔNIA etwa mit den Arbeiten von Jimmy Nelson, vor allem dessen Werkgruppe „Before They Pass Away“, wird die gleiche Tendenz zur exotischen Darstellung von „anderen“ Kulturen sichtbar. Nelson, so der Vorwurf, stelle (etwa in der Nachfolge der romantisierenden Indianer-Fotografie des US-amerikanischen Fotografen Edward Curtis) indigene Völker in einer Weise dar, die sie fast zu musealen Objekten macht.
Das Dilemma der Dokumentarfotografie besteht seit ihrer Erfindung darin, die Wirklichkeit in ihrer komplexen, fremden Vielfalt auf Sehgewohnheiten und soziale Bedürfnisse ihrer Betrachter zu reduzieren, die sich gerade außerhalb dieser fernen Welten gebildet haben. Leistet sie diese Anpassung nicht, bliebe sie weitgehend unbeachtet.
Die Beschäftigung mit dem kulturell Fremden zieht sich als Konstante durch die moderne Kulturgeschichte. Die Konstruktion des ursprünglichen, unschuldigen, gleichsam paradiesischen „Edlen Wilden“, erstmals im 18. Jahrhundert von einem der berühmten französischen Philosophen der Aufklärung, Jean-Jacques Rousseau, formuliert ist nach dem Religionswissenschaftler Mircea Eliade eher die „Schöpfung einer Erinnerung“. Gerade die Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gerne auch Klassische Moderne genannt, zog den „Primitivismus“ als eine ihrer Hauptquellen heran. Künstler wie Paul Gauguin oder Henri Rousseau, Picasso oder Matisse, Paul Klee oder Ernst Ludwig Kirchner bezogen den exotistischen Gegenentwurf in ihrer Zivilisationskritik mit ein.
Exotismus als ästhetische Rebellion, als koloniale Projektion
Die Kritik an dieser Sichtweise setzte erst später ein. Claude Lévi-Strauss, dessen Hauptwerk (Traurige Tropen) 1955 in Paris erschien, oder der US-amerikanische Literatur-Theoretiker Edward Said, dessen Werk „Orientalismus“ 1978 erschien, übten postkoloniale Exotismus-Kritik, indem die westlichen Sichtweisen als „Stil der Herrschaft, Umstrukturierung und des Autoritätsbesitzes über den Orient“ herausgestellt wurden.
In der Nachfolge haben zeitgenössische Ethnologen wie der Brasilianer Eduardo Viveiros de Castro betont, dass indigene Völker nicht in einem „frühesten“ oder „ursprünglichen“ Zustand leben, sondern hochkomplexe, dynamische Kulturen besitzen, die im ständigen Dialog mit der Welt stehen. Sie schaffen ihre eigenen Verhältnisse zur Natur, die nicht in romantischen oder idealisierten Begriffen gefasst werden sollten.
concerned audience

Neue Fototheorien, wie die concerned audience, verstehen Fotografie als Mittel, eine bessere Gesellschaft zu imaginieren und zu verwirklichen. Fotojournalismus wie der von Salgado kann so als transformative Kraft verstanden werden, die eine Debatte über die Gesellschaft anstößt und vom Betrachter ein Mitdenken, Mitfühlen und Handeln abverlangt.
Die Arbeitsweise von Sebastião Salgado, insbesondere sein Umgang mit der Finanzierung und Veröffentlichung seiner Langzeitprojekte, wird als wegweisend für zukünftigen Fotojournalismus diskutiert. In Zeiten, in denen Redaktionen immer weniger in der Lage sind, aufwendige Recherchen zu finanzieren, hat Salgado einen Weg gefunden, unabhängig zu arbeiten.
AMAZÔNIA ist, wie man jetzt in Köln sehen kann, ein äußerst wichtiges und berührendes Werk. Die wunderschönen, monumentalen Fotografien sind als Aufruf zu verstehen, sich mit der drängenden Realität auseinanderzusetzen. Doch mäandert die Ausstellung zwischen Ästhetik und Aktivismus, zwischen Nostalgie, Romantik und politischem Handeln, steht in einem ambivalenten Spannungsfeld zwischen Ethik und stark stilisierter Schwarz-Weiß-Ästhetik. Ein Paradox bleibt: Einerseits hebt Salgado die Würde und Persönlichkeit der dargestellten Menschen hervor, andererseits entzieht die Ästhetisierung den Szenen oftmals ihren historischen und politischen Kontext.
Salgados Bilder sind fotografische Meisterwerke, auratisch und erhaben. Sie verschonen uns mit spezifischen politischen Konflikten, zeigen keine Gewalt, selten Spuren kolonialer Zerstörung – dafür umso mehr eine mythische Harmonie von Mensch und Natur.
Marc Peschke
Sebastião Salgado (1944–2025) begann 1973 seine Karriere als Fotograf in Paris und arbeitete in der Folge für die Fotoagenturen Sygma, Gamma und Magnum Photos. Im Jahr 1994 gründete er gemeinsam mit seiner Frau Lélia Wanick Salgado die Agentur Amazonas Images, die sein Werk exklusiv vertritt. Aus den Werken, die Sebastião Salgado geschaffen hat, ragen drei Langzeitprojekte hervor: Workers (1993) dokumentiert das allmähliche Verschwinden traditioneller handwerklicher Arbeit weltweit und Migrations (2000) die massenhaften Wanderungsbewegungen, die durch Kriege, Unterdrückung, Hunger, Naturkatastrophen sowie Umweltzerstörung verursacht werden. GENESIS, hat sich ein Ziel gesetzt, dem auch das von Sebastião und Lélia Salgado begründete Instituto Terra verpflichtet ist: unser Bewusstsein dafür zu schärfen, wie kostbar die letzten unberührten Winkel unserer Welt sind – für uns selbst wie für zukünftige Generationen.
Lélia Wanick Salgado studierte Architektur und Stadtplanung in Paris. Ihr Interesse für die Fotografie entdeckte sie 1970. Seit den 1980er-Jahren konzipiert und gestaltet sie die Mehrzahl der Fotobände von Sebastião Salgado und organisiert alle Ausstellungen seines Werkes.
AMAZÔNIA –PHOTOGRAPHS BY SEBASTIÃO SALGADO
29. Oktober bis 15. März 2026
Rautenstrauch-Joest-Museum, Cäcilienstraße 29–33, Köln
Sebastião Salgado. Genesis
Taschen Verlag, Edition von 2.500 Ex., 2 Bd mit Buchständer, 704 Seiten, 3.500 Euro
Hinweis
Am 4. November findet in der Kölner Philharmonie ein Konzert des Gürzenich-Orchesters statt, das Musik mit den Fotografien von Sebastião Salgado verbindet. Die italienisch-brasilianische Dirigentin Simone Menezes leitet ein Programm mit Werken von Heitor Villa-Lobos und Philip Glass.
Lesen Sie weiter