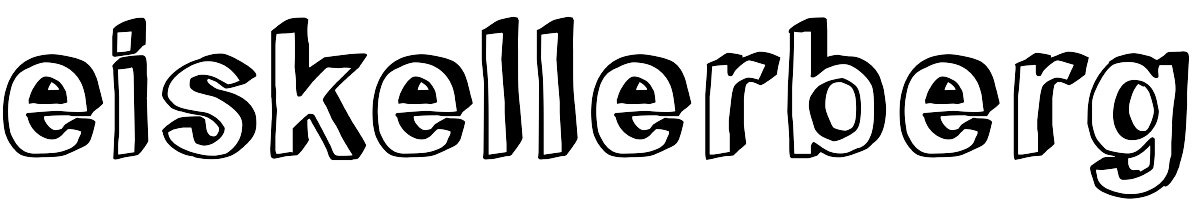Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ prägt die Diskussion um Innovation und technische Entwicklung. Die neuen Tools „Open AI“ und „Chat GPT“, um nur einige zu nennen, werden, obwohl jung (Chat GPT wurde 2022 vorgestellt und zugänglich gemacht), weiträumig erprobt und angewendet, auch von kreativen Menschen im Bildbereich: Bildende Kunst im traditionellen und erweiterten Sinne, Fotografie und Design sind betroffen, aber auch verwandte Medien wie Berichterstattung und die Erstellung von Dokumentationen. Erst recht alarmiert sind die Kreativbereiche Wort und Musik, die am Anfang der Nahrungskette der neuen und sich ständig wandelnden Tools stehen.
Die neuen Technologien eröffnen Chancen und Risiken; nach derzeitigem Stand überwiegen allerdings die Risiken, weshalb das Wort vom „Größten Diebstahl der Weltgeschichte“ die Runde macht. Es weist darauf hin, dass KI auch im Wort- Bild und Musikbereich auf der Grundlage von unendlich großen Mengen eingelesener Werke entwickelt wurde.
Unbegründete Kritik
Die Politik in Europa hat früh gehandelt. Die wegen der unbegründeten Kritik an der angeblichen Einführung on Uploadfiltern bekannt gewordene „Internetrichtlinie“ der EU von 2019, längst in deutsches Recht umgesetzt, befasste sich u.a. mit der angemessenen Vergütung der Rechtsinhaber für Werknutzungen auf Plattformen, die private Vervielfältigungen ermöglichen (Youtube etc.) und einer Anpassung des Urheberrechts an digitale Nutzungen.
Von künstlicher Intelligenz war da noch nicht die Rede. Nur in einem Punkt wurde ein trojanisches Pferd eingeschleust: Das sog. Text- und Datamining erlaubt zu vorrangig wissenschaftlicher Nutzung und weitgehend ohne Vergütung das Scannen ganzer Datenbanken. Es ist nicht deutlich genug formuliert und bildet heute eine von KI – Entwicklern genutzte rechtliche Grauzone.
Dem Text- und Data-Mining kommt große Bedeutung zu, beruht die KI doch im Wesentlichen auf dem Sammeln großer Datenmengen von bereits existierenden Werken aller Genres und dem darin verkörperten Wissen.
Im August 2024, für ihre Verhältnisse diesmal außerordentlich schnell, verabschiedete die EU die weltweit erste AI-Verordnung, die anstrebt, als erster Regulierungsschritt der KI zu gelten, aber, wie die Anwendungspraxis zeigt, wesentliche Lücken enthält.
Im Bereich Bildende Kunst haben die Interessenvertreter der Betroffenen ebenfalls schnell gehandelt. Im Juni 2024 veröffentlichten die Stiftung Kunstfonds und die von vielen wesentlichen Urheberverbänden vor 20 Jahren gegründete „Initiative Urheberrecht“ als Diskussionsgrundlage die erste fundierte Studie „KI und Bildende Kunst“, erstellt von der einschlägig erfahrenen Agentur Goldmedia und zugänglich auf den Websites der Auftraggeber. Sie befasst sich auch mit den schon stattfindenden Anwendungen im Bereich der betroffenen Künstlerinnen und Künstler. Sie zeigt aber auch, dass KI-Software ein willkommenes Werkzeug für Kreative im Bildbereich ist.
Für die Abschätzung der Folgen der KI auf die Einkommenssituation der Künstlerinnen und Künstler wird eine Studie wichtig werden, die der BBK und die Stiftung Kunstfonds mit Unterstützung des BKM derzeit vorbereiten.
Kreativ-Booster oder Bedrohung? Initiative Urheberrecht nimmt KI ins Visier
Kürzlich fand außerdem die jährlich stattfindende 12. Urheberkonferenz der Initiative Urheberrecht in Berlin statt. Im Mittelpunkt der Konferenz standen ebenfalls die Auswirkungen der KI auf den Kultursektor. Das breite Medienecho zeigt, wie weit die Betroffenheit im gesamten Kulturbereich mittlerweile ist. Die Diskussion von Vertretern und Vertreterinnen nahezu aller Kultursparten zeigt aber auch, dass das Bewusstsein gemeinsamen Handelns angesichts der Bedeutung der Entwicklung unabdingbar ist.
Klar ist schon jetzt, dass die Umwälzungen die zukünftige Arbeit ganzer Berufsgruppen betreffen. So berichteten z.B. Übersetzer, dass ihre Arbeit sich immer mehr darauf konzentriert, KI-angefertigte Übersetzungen mit dem Originaltext zu vergleichen und zu prüfen, ob und welche Fehler die KI gemacht hat – nicht gerade die Tätigkeit, für die sie ausgebildet wurden und wesentlich schlechter bezahlt.
Bildende Künstler und Künstlerinnen müssen nach derzeitigem Stand geringere Sorgen haben, wenn sie in traditionellen Techniken arbeiten: Fälschungen gab es schon immer, wenn auch menschengemacht. Aber in der Medienkunst im weitesten Sinne wird es nicht mehr lange dauern, bis generative KI auch werkähnliche Produkte schafft.
Wesentlich gravierender und existenzbedrohender sind dagegen die Entwicklungen in der Musik: Hintergrundmusik für TV-Werke und Programme schafft jede gut trainierte KI schon heute. Bei Texten für den Alltagsgebrauch wird KI ebenfalls fast flächendeckend – und jobgefährdend – alltäglich genutzt.
Woher bezieht KI ihr Wissen?
Was planen die Organisationen, um mit den von KI geschaffenen Problemen umzugehen?
Erste Ziel ist die Durchsetzung der von der EU-Verordnung geforderten Transparenz der KI-Entwickler, die bisher nicht detailliert ausformuliert ist. Erreicht werden soll, dass die Hersteller von Programmen auf KI-Basis offenlegen, woher ihre Instrumente ihr Wissen haben. Denn klar ist ja, dass KI-Programme ihre Fähigkeiten und Erzeugnisse auf der Grundlage von Milliarden gespeicherter Werke erzeugen. Für die Rechtinhaber ist es schwer, aber nicht unmöglich, nachzuweisen, dass ein von ihnen geschaffenes Werk, z.B. ein Foto, von einer KI genutzt wird, ohne die urheberrechtlich erforderliche Genehmigung des Fotografen oder der Fotografin. Ein Musterprozess läuft bereits.
Nächstes Ziel – nach dem alten urheberrechtlichen Grundsatz „if you cannot beat them, license them“ – ist, Vergütungen für die massenhafte Nutzung von geschützten Werken zum Training von KI durchzusetzen bzw. „opt-out“-Lösungen zu entwickeln, die es einzelnen Urheberinnen und Rechtsinhabern ermöglichen, aus kollektiven Lizenzmodellen auszusteigen und die Nutzung ihrer Werke generell zu verbieten. Inwieweit so etwas in der Praxis wirklich funktioniert, ist allerdings eine Frage der individuellen Durchsetzungsstärke.
Die VG Wort entwickelt derzeit ein Lizenzmodell für wenige, den Autoren zumutbare Nutzungen. Mit ähnlichen Lizenzmodellen über Verwertungsgesellschaften werden technisch möglich gewordene und individuell nicht mehr kontrollierbar gewordene Kulturtechniken auf gesetzlicher Grundlage bis heute kollektiv abgerechnet. Dazu gehört das Mitschneiden von Radiosendungen, die private Kopie von Texten und bewegten und stehenden Bildern mit zunächst elektronischen und jetzt digitalen Mitteln. Die Gema entwickelt auf dieser Basis, aber mit der Möglichkeit stärkerer individueller Mitgestaltung ebenfalls ein Lizenzmodell für die Nutzung von musikalischen Werken durch KI.
Der Geist ist aus der Flasche
Solche Lizensierungsmodelle konnten in der Vergangenheit das Problem der technisch möglichen, aber individuell nicht mehr verbietbaren und auch nicht lizensierbaren Vervielfältigungen recht und schlecht wenigstens mit Geld lösen, das den Berechtigten durch Verwertungsgesellschaften zufloss. Heute stellt sich die Frage, ob sie der Problematik wirklich gerecht werden, denn sie funktionieren immer nur auf der Basis einer generellen Erlaubnis des Eingriffs in fremde Werke.
Was aber macht Gerhard Richter, wenn er an derartigen Vergütungen kein Interesse hat und nichts weiter will als die Nutzung seiner Werke für die KI-Industrie generell zu verhindern? Der Geist ist aus der Flasche. Man wird Richter und anderen nicht helfen können, weil kaum zu ermitteln ist, welcher KI-Entwickler welches Werk genutzt hat.
Klar ist, nationale Lösungen helfen nichts angesichts eines weltweiten Marktes für KI. Die europäische Gesetzgebung hat diesmal zwar schnell regiert, aber ohne Verständigung mit den USA und anderen Großmächten des „Geistigen Eigentums“ wird es kein weltweit funktionierendes Modell der Regulierung geben.
Bisher haben weltweite Konventionen das geistige Eigentum und damit eine wesentliche Existenzgrundlage der Kreativen und der Kulturindustrie recht und schlecht gesichert. Aber werden Trump und sein Buddy Musk an der Entwicklung derartiger internationaler Netzwerke der Gesetzgebung interessiert sein? Werden die Chinesen mitmachen? Schwer vorstellbar im Augenblick.
Umso wichtiger ist es, dass die Kreativbranchen in Deutschland und Europa wachsam sind und Druck auf die Regierenden machen, um die Zerstörung ganzer Branchen und flächendeckende Enteignungen von Künstlern und Kreativen zu verhindern. Die kommenden Koalitionsvereinbarungen in Deutschland bieten die beste Gelegenheit, die notwendigen Schritte zu formulieren, die die nächste Bundesregierung dann in Brüssel durchsetzen wird.
Bis Juni 2021 war Gerhard Pfennig Sprecher der Initiative Urheberrecht (IU). Der Urheberrechts- und Kunstexperten hat sich für die EU-Richtlinien im Bundestag und dem damit einhergehenden Paradigmenwechsel bei der Plattformhaftung eingesetzt. Von 1978 bis 2011 war er Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der VG Bild-Kunst. Dazu übte er von 1980 bis 2010 die Funktion des Geschäftsführers der Stiftung Kunstfonds aus und wechselte anschließend in den Vorstand. Von 1973 bis 1988 war er Geschäftsführer des Bundesverbands Bildender Künstler BBK, seither unterstützte er den Verband als Justiziar. Pfennig verfasste er zahlreiche Veröffentlichungen zu Fragen des Urheberrechts und der Kulturpolitik.

Unser Autor
Bis Juni 2021 war Gerhard Pfennig Sprecher der Initiative Urheberrecht (IU). Der Urheberrechts- und Kunstexperten hat sich für die EU-Richtlinien im Bundestag und dem damit einhergehenden Paradigmenwechsel bei der Plattformhaftung eingesetzt. Von 1978 bis 2011 war er Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der VG Bild-Kunst. Dazu übte er von 1980 bis 2010 die Funktion des Geschäftsführers der Stiftung Kunstfonds aus und wechselte anschließend in den Vorstand. Von 1973 bis 1988 war er Geschäftsführer des Bundesverbands Bildender Künstler BBK, seither unterstützte er den Verband als Justiziar. Pfennig verfasste er zahlreiche Veröffentlichungen zu Fragen des Urheberrechts und der Kulturpolitik.
Zur Studie
„KI und Bildende Kunst“
https://urheber.info/diskurs/deutschlandweit-erste-studie-zu-auswirkungen-von-ki-auf-bildende-kunst
Buchtipp
Ray Kurzwell: „Die nächste Stufe der Evolution“. Wenn Mensch und Maschine eins werden. Piper Verlag, München 2024
Vortrag
Sophie Wennerscheid
Maschinenliebe. Intimität im Zeitalter Künstlicher Intelligenz
Wenn und Aber. Philosophische Fragen zur Zeit
Donnerstag, 12. Dezember 2024, 18.30 Uhr
Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI), Gartensaal
Goethestraße 31, 45128 Essen
Sex mit Robotern und Intimität mit KI – ein Guilty Pleasure, an dem sich das Begehren unserer Gegenwart artikuliert? Viele Menschen wünschen sich eine lustvolle Liebesbeziehung, in der sie sich und die Welt neu erleben. Gleichzeitig macht dieses Neue Angst und weckt das Bedürfnis nach Sicherheit und Selbstbestätigung. Mit der Schaffung virtueller Welten und der Fertigung von lebensechten Sexpuppen und humanoiden Robotern, die versprechen, uns jeden Wunsch zu erfüllen, scheint die Möglichkeit gegeben, dieses widersprüchliche Begehren zu stillen. Doch was ist damit gewonnen, und was geht verloren?